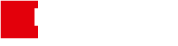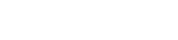Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Jo ák, Matú; Sonderegger, Walter; Niemz, Peter; Holm, Andreas; Krus, Martin; Großkinsky, Theo; Lengsfeld, Kristin; Grunewald, John; Plagge, Rudolf | Vergleichende Untersuchungen zum Feuchte- und Wärmeverhalten unterschiedlicher Holzbauelemente | Bauphysik | 5/2011 | 287-298 | Fachthemen |
KurzfassungAuf dem Freilandversuchsgelände des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Holzkirchen wurde das Feuchte- und Wärmeverhalten verschiedener Wandaufbauten aus Holz (geschlitzte Holzkonstruktion, Massivholzkonstruktion, Dämmsteinkonstruktion, Holzplattenkonstruktion, Brettstapelkonstruktion) über die Dauer eines Jahres getestet. Folgende Größen wurden gemessen: Innenraumklima, Außen- und Innenoberflächentemperaturen sowie die Temperaturen an den Grenzschichten, die Wärmestromdichte auf der Innenseite der Bauteile, die relative Luftfeuchte sowie die Holzfeuchte. Das Ziel der Arbeit war einerseits, die verschiedenen Aufbauten unter realen Bedingungen zu vergleichen, andererseits wurden die ermittelten Messdaten für Validierungsberechnungen mittels der Simulationssoftware WUFI®Pro und Delphin verwendet. Die gemessenen, instationären U-Werte stimmen in den Wintermonaten mit den stationär bestimmten Werten gut überein. Bei den Simulationsberechnungen ergeben sich deutlich bessere Ergebnisse, wenn die an der ETH Zürich gemessenen deutlich tieferen Wärmeleitfähigkeiten für Holz anstelle der Normwerte in die Simulation eingesetzt werden. Obwohl bei vier Bauelementen keine Hinterlüftung der Holzfassade bestand, wurden keine kritischen Werte bezüglich der relativen Luftfeuchte innerhalb jener Wandkonstruktionen gemessen. Bei der Simulation der relativen Luftfeuchten zeigten beide Programme teilweise starke Abweichungen gegenüber den gemessenen Werten. x | |||||
| Schnider, Thomas; Niemz, Peter; Steiger, Benjamin; von Arx, Urs | Untersuchungen zum Versagen von Klebfugen unter klimatischer Langzeitbeanspruchung | Bauphysik | 1/2011 | 27-32 | Fachthemen |
KurzfassungAn Klebverbindungen werden im Konstruktiven Holzbau hohe Anforderungen hinsichtlich Güte und Dauerhaftigkeit gestellt. Mit 1-K PUR, MUF und PRF verklebte Lamellen aus Rotbuche und Fichte wurden einer Freibewitterung, einer künstlichen Bewitterung und einem feucht-trocken Wechselklima ausgesetzt. Nach einer abgestuften Behandlungsdauer wurden die Zugscherfestigkeit sowie die Schalllaufzeit senkrecht zur Klebfuge und die Eigenfrequenz bei Biegeschwingungen bestimmt. Ergänzend wurde die Delaminierungsbeständigkeit an Brettschichtholz aus Fichte nach DIN EN 302-2 durchgeführt. Im untersuchten Behandlungszeitraum wurde bei allen Proben keine erkennbare Delaminierung festgestellt. Ein Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und Zugscherfestigkeit konnte nicht nachgewiesen werden. Ebenso bestand keine gesicherte Korrelation zwischen der Zugscherfestigkeit und der Schalllaufzeit sowie der Eigenfrequenz. x | |||||
| Jo ák, M.; Sonderegger, W.; Niemz, P. | Wärme- und Feuchtetransport in Holzbauelementen unter freier Bewitterung | Bauphysik | 5/2010 | 308-318 | Fachthemen |
KurzfassungEs wurden vergleichende Untersuchungen des Wärme- und Feuchtetransportes in unterschiedlichen Holzbaukonstruktionen unter freier Bewitterung durchgeführt. Insgesamt wurden fünf Konstruktionen an Versuchsbauten auf dem Gelände der ETH Zürich getestet. Neben einer verdübelten Massivholzkonstruktion wurden zwei Ständerkonstruktionen und zwei weitere Vollholzkonstruktionen untersucht. Aus den gewonnenen Daten wurden dynamische Parameter der Gebäudehüllen ermittelt. Zusätzlich wurden Messungen an drei realen Bauten (zwei verdübelte Massivholzkonstruktionen, eine Ständerkonstruktion) durchgeführt. Die gemessenen Daten der Versuchsbauten wurden mit den Daten der Messungen an realen Bauten verglichen. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass die Vollholzkonstruktionen sehr ausgewogene, hygrothermische Eigenschaften aufweisen. x | |||||
| Kehl, D.; Weber, H.; Hauswirth, S. | Ist die Hinterlüftung von Holzfassaden ein Muss? | Bauphysik | 3/2010 | 144-148 | Fachthemen |
KurzfassungNach Durchführung einer großen Schweizer Forschungsinitiative zum Thema “Brandschutz im Holzbau” sind seit 2005 Außenwandbekleidungen aus Holz unter Zuhilfenahme von bestimmten Brandschutzmaßnahmen bis zur Hochhausgrenze (22 m) möglich [1]. Dazu zählen unter anderem auch Außenwandbekleidungen, deren Hinterlüftungsraum geschossweise unterbrochen und oben verschlossen wird. Solche Fassaden weisen brandschutztechnische Vorteile auf, da sie die Brandweiterleitung hinter der Bekleidung reduzieren bzw. verhindern. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, ob eine Hinterlüftung von Holzfassaden aus bauphysikalischer Sicht überhaupt notwendig ist. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens an der Berner Fachhochschule - Architektur, Holz und Bau in Biel/Bienne wurde dieser Frage nachgegangen [2]. x | |||||
| Werther, N.; Winter, S. | Klimatische Verhältnisse in Kriechkellern unter gedämmten Holzbodenplatten | Bauphysik | 2/2009 | 59-64 | Fachthemen |
KurzfassungHochgedämmte Holzbodenplatten über Kriechkellerkonstruktionen als unterer Abschluss eines Gebäudes kamen in den letzten Jahren im Bereich des Wohn- und Zweckbaus in Holzbauweise vermehrt zur Anwendung. Fehlende Kenntnis zu den im Kellerbereich herrschenden Mikroklimabedingungen und die sich daraus ergebenden Nutzungsrandbedingungen für Holz und Holzwerkstoffe führten zu unterschiedlichen Konstruktionsformen. Mittels Langzeitmessungen im Feld- und Laborversuch wurden Konstruktionsprinzipien entwickelt, die einen dauerhaften Einsatz von Holzbodenplatten über belüfteten Kriechkellern sicherstellen. x | |||||
| Eßmann, F. | Holzbau und Holzschutz von A bis Z (Hähnel, E.) | Bauphysik | 2/2008 | 133 | Bücher |
| Frangi, A.; Fontana, M.; Bochicchio, G. | Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Brandverhalten von Brettsperrholzplatten | Bauphysik | 6/2007 | 387-397 | Fachthemen |
KurzfassungBrettsperrholzplatten stellen ein technisch und wirtschaftlich interessantes Produkt für den ?modernen? Massivholzbau dar und finden in den letzten Jahren einen vermehrten Einsatz als großformatige Wand- und Deckenelemente im Wohnungsbau. Im Rahmen von zwei am Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich und am Institut CNR-IVALSA in San Michele all?Adige, Italien, laufenden Forschungsprojekten wurde das Brandverhalten von Brettsperrholzplatten mit mehreren experimentellen und numerischen Untersuchungen analysiert. Der vorliegende Artikel stellt die brandschutztechnisch relevanten Erkenntnisse aus den Untersuchungen dar und analysiert die grundsätzliche Fragestellung, ob sich im Brandfall Brettsperrholzplatten ähnlich wie Vollholzplatten verhalten. Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass das Brandverhalten von Brettsperrholzplatten durch das Verhalten der einzelnen Bretterlagen charakterisiert ist. Falls sich die einzelnen verkohlten Schichten frühzeitig ablösen, geht die Schutzwirkung der sich bildenden Holzkohleschicht verloren. Nach der Verkohlung und dem Abfallen jeder einzelnen Schicht ist in diesem Fall wegen der steigenden Brandraumtemperatur mit einem erhöhten Abbrand zu rechnen, ähnlich wie für geschützte Holzbauteile nach dem Versagen der Brandschutzbekleidung. Das Brandverhalten von Brettsperrholzplatten kann somit durch die Plattenschichtigkeit und die Dicke der einzelnen Schichten stark beeinflusst werden. Das Ablösen der Holzkohleschicht könnte für horizontale Bauteile (Decken) kritischer sein als für vertikale Bauteile (Wände). x | |||||
| Hosser, D.; Kampmeier, B. | Anwendung brennbarer Dämmstoffe im mehrgeschossigen Holzbau | Bauphysik | 4/2007 | 313-318 | Fachthemen |
KurzfassungIn einem Verbundforschungsvorhaben wurde mit Hilfe von Brandversuchen im Labormaßstab und im Realmaßstab untersucht, ob brennbare Dämmstoffe auch im mehrgeschossigen Holztafelbau der Gebäudeklasse 4 eingesetzt werden können. Im Vergleich zu Gebäuden mit nichtbrennbarer Dämmung erhöht sich das Brandrisiko nicht, wenn durch Einhaltung bestimmter konstruktiver Randbedingungen eine Entzündung der brennbaren Dämmung und eine kritische Rauchgasentwicklung verhindert werden. x | |||||
| Bietz, H.; Scholl, W. | Zur Überarbeitung der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" unter besonderer Berücksichtigung des Holz-/ Leichtbaus | Bauphysik | 6/2006 | 349-355 | Fachthemen |
KurzfassungDie Norm DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau regelt alle Belange rund um den baulichen Schallschutz. Hierzu gehören sowohl die Festlegung von Anforderungen, als auch die Beschreibung von Verfahren, mit denen ein geforderter Schallschutz vorhergesagt werden kann (sog. Prognoseverfahren). Weiterhin wird beschrieben, wie ein meßtechnischer Schallschutznachweis grundsätzlich durchzuführen ist. Die Prognoseverfahren beinhalten auch einen Bauteilkatalog mit der Beschreibung der bauakustischen Kenngrößen üblicher Bauteile. DIN 4109 wird zur Zeit aus verschiedenen Gründen komplett überarbeitet. Es werden die Hintergründe der Überarbeitung erläutert sowie die Struktur der neuen Norm vorgestellt. Insbesondere wird auf die Erarbeitung eines neuen Bauteilkataloges für den Bereich der im Holzbau bzw. Leichtbau üblichen Bauteile eingegangen, wobei der jetzt erstellte Bauteilkatalog auch anhand von Beispielen vorgestellt wird. Weiterhin wird auf den aktuellen Sachstand der Überarbeitung von DIN 4109 eingegangen. x | |||||
| IBH-Wärmebrückenkatalog um Holzbaudetails erweitert | Bauphysik | 5/2005 | 311 | Aktuelles | |
| Frangi, A.; Fontana, M. | Bemessung von Holzdecken aus Hohlkastenelementen im Brandfall | Bauphysik | 4/2005 | 217-227 | Fachthemen |
KurzfassungDer Beitrag stellt eine vereinfachte Berechnungsmethode zur Bemessung von Holzdecken aus Hohlkastenelementen bei Normbrandbeanspruchung vor. Die vereinfachte Berechnungsmethode orientiert sich an der vereinfachten Bemessungsmethode mit reduziertem Querschnitt für Holzbauteile im Brandfall gemäß Eurocode 5 und berücksichtigt zwei Brandphasen - vor und nach der vollständigen Verkohlung der unteren, direkt dem Feuer ausgesetzten Holzlamelle. Es werden die vereinfachte Berechnungsmethode vorgestellt und die Resultate von Brandversuchen mit der Bemessungsmethode verglichen. x | |||||
| Frangi, A.; Fontana, M. | Brandverhalten von Hohlkastendecken aus Holz | Bauphysik | 1/2005 | 42-51 | Fachthemen |
KurzfassungDer vorliegende Artikel dokumentiert die wesentlichen Resultate von experimentellen Untersuchungen zum Brandverhalten von Holzdecken aus Hohlkastenelementen und schafft Grundlagen für die Beurteilung des Brandverhaltens von Deckenkonstruktionen aus Holz bei längerer Branddauer für Geschoßbauten. Die Versuche sind Teil der längerfristig angelegten Forschungen zum vermehrten Einsatz der ökologischen Holzbauweise in mehrgeschossigen Bauten. Im Vordergrund der Untersuchungen standen daher die experimentelle Überprüfung des Brandverhaltens der Hohlkastendecken insbesondere des Tragwiderstandes für längere Feuerwiderstandszeiten. Im Weiteren wurde auch der Einfluss von unterschiedlichen Fugenkonstruktionen, der Einsatz von Akustik-Lochungen sowie auch die Brandschutzwirkung verschiedener Dämmaterialien untersucht. x | |||||
| Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise - M-HFHHoIzR (Fassung Juli 2004) | Bauphysik | 6/2004 | 394 | Technische Regelsetzung | |
| Korjenic, A.; Zach, J.; Dreyer, J.; Stastnik, S. | Untersuchung der thermisch-hygrischen Eigenschaften von Ziegeln mit Hohlraumfüllung aus Recyclingmaterial | Bauphysik | 1/2004 | 1-5 | Fachthemen |
KurzfassungIn dem Forschungsprojekt wurde untersucht, ob Ziegel mit einfacher Hohlraumstruktur durch Verwendung einer wärmedämmenden Hohlraumfüllung einen höheren Wärmedurchlaßwiderstand haben. Als Dämmstoff wurde ein Recyclingdämmaterial aus Reststoffen aus der Produktion von Polystyrolplatten sowie Holzbauteilen, die mittels Zementlein zu einem Gemisch verarbeitet wurden, verwendet. Es wurde der Einfluß von Anordnung und Stärke der Dämmschicht sowie von Lage und Geometrie der Hohlräume des Ziegelbausteines auf die thermisch-hygrischen Zustände untersucht. Für die Untersuchung der thermischen Eigenschaften und der Ermittlung der Wärmedurchgangskoeffizienten wurde das Programm THERM verwendet, das den Wärmetransport durch Wärmeleitung im Ziegelscherben und die Transportmechanismen Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung in den luftgefüllten Hohlräumen berücksichtigt. Zur Untersuchung des Feuchtigkeitstransports in den Ziegelsteinen wurde das Programmpaket WUFI 2D verwendet. Die Untersuchungen haben gezeigt, daß die so strukturierten Ziegel-Verbundsteine einen etwa doppelt so hohen Dämmwert haben, wie der ursprüngliche Ziegelstein. Die hygrischen Zustände können im Ziegel teilweise über 80 % Luftfeuchtigkeit betragen. Diese Belastung wird als unkritisch eingeschätzt, weil die Holzpartikel mit Zementschlämme umhüllt sind. x | |||||
| DIN V ENV 1995-1-2 (Vornorm) Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung für den Brandfall; Deutsche Fassung ENV 1995-1-2:1995 | Bauphysik | 5/2003 | 324 | Technische Regelsetzung - Neue Normen | |
| DIN V ENV 13381-7:2003-09 Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen - Teil 2: Brandschutzmaßnahmen für Holzbauteile; Deutsche Fassung ENV 13381-7:2002 | Bauphysik | 5/2003 | 327 | Technische Regelsetzung - Neue Normen | |
| Schneider, U.; Oswald, M. | Brandrisiko in Wohngebäuden unterschiedlicher Bauart, Teil 2 | Bauphysik | 4/2003 | 177-186 | Fachthemen |
KurzfassungDie aktuelle Musterbauordnung vom Oktober 2002 sieht die Gleichstellung tragender Baukonstruktionen in der neuen Gebäudeklasse 4 vor, d. h. bis zu einer Gebäudehöhe von 13 m dürfen diese Konstruktionen in Massivbauweise oder Holzbauweise errichtet werden. Aufgrund des damit verbundenen erhöhten Brandrisikos im Geschoßwohnbau wurde die Erarbeitung einer Muster-Holzbaurichtlinie mit neuen Konstruktionsvorschriften für den mehrgeschossigen Holzwohnbau notwendig. Damit sollen die bestehenden Schwachstellen im Geschoßwohnbau beseitigt werden. Daß diese Vorgehensweise dringend erforderlich ist, haben die vorliegenden Untersuchungen an bestehenden Gebäuden bestätigt. Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, daß das Risikopotential durch das Ereignis "Brand" im Wohnbau in starker Abhängigkeit von der Art der Bauweise steht. Die Möglichkeit der gestalterischen Freiheit, die Planern und Bauherren mit den neueren Entwicklungen in den Rechtsgrundlagen geboten werden, erfordern verantwortungsbewußte Planung, um nicht ein Absinken des Sicherheitsniveaus zu riskieren. Die Verwendung von brennbaren Stoffen in mehrgeschossigen tragenden Gebäudekonstruktionen erfordert die Betrachtung der Tragfähigkeit des Gesamtsystems und nicht der Brandwiderstandsdauer einzelner Bauteile. Dies betrifft vor allem den Mehrgeschoßbau, da das Versagen einzelner Bauelemente und deren Verbindungen katastrophale Folgen für das gesamte Gebäude haben kann. Die gültigen Normen DIN 4102 und ÖNORM B 3800 sowie die betreffenden Eurocodes berücksichtigen bereits weitgehend, daß Bauteile nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Dazu sind grundlegende Kenntnisse über den Brandschutz erforderlich, insbesondere sind die konstruktiven Schwachpunkte wie Anschlüsse und Verbindungen zu beachten und zu bewerten. x | |||||
| Schneider, U.; Oswald, M. | Brandrisiko in Wohngebäuden unterschiedlicher Art, Teil 1 | Bauphysik | 3/2003 | 122-130 | Fachthemen |
KurzfassungDie aktuelle Musterbauordnung vom Oktober 2002 sieht die Gleichstellung tragender Baukonstruktionen in der neuen Gebäudeklasse 4 vor, d. h. bis zu einer Gebäudehöhe von 13 m dürfen diese Konstruktionen in Massivbauweise oder Holzbauweise errichtet werden. Aufgrund des damit verbundenen erhöhten Brandrisikos im Geschoßwohnbau wurde die Erarbeitung einer Muster-Holzbaurichtlinie mit neuen Konstruktionsvorschriften für den mehrgeschossigen Holzwohnbau notwendig. Damit sollen die bestehenden Schwachstellen im Geschoßwohnbau beseitigt werden. Daß diese Vorgehensweise dringend erforderlich ist, haben die vorliegenden Untersuchungen an bestehenden Gebäuden bestätigt. Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, daß das Risikopotential durch das Ereignis "Brand" im Wohnbau in starker Abhängigkeit von der Art der Bauweise steht. Die Möglichkeit der gestalterischen Freiheit, die Planern und Bauherren mit den neueren Entwicklungen in den Rechtsgrundlagen geboten werden, erfordern verantwortungsbewußte Planung, um nicht ein Absinken des Sicherheitsniveaus zu riskieren. Die Verwendung von brennbaren Stoffen in mehrgeschossigen tragenden Gebäudekonstruktionen erfordert die Betrachtung der Tragfähigkeit des Gesamtsystems und nicht der Brandwiderstandsdauer einzelner Bauteile. Dies betrifft vor allem den Mehrgeschoßbau, da das Versagen einzelner Bauelemente und deren Verbindungen katastrophale Folgen für das gesamte Gebäude haben kann. Die gültigen Normen DIN 4102 und ÖNORM B 3800 sowie die betreffenden Eurocodes berücksichtigen bereits weitgehend, daß Bauteile nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Dazu sind grundlegende Kenntnisse über den Brandschutz erforderlich, insbesondere sind die konstruktiven Schwachpunkte wie Anschlüsse und Verbindungen zu beachten und zu bewerten. x | |||||
| Famers, G. | Die Brandschutzvorschriften der neuen Musterbauordnung | Bauphysik | 3/2003 | 131-136 | Fachthemen |
KurzfassungDie ARGEBAU (Konferenz der für das Bauwesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder) hat im November 2002 eine neue Musterbauordnung verabschiedet. Neben der Änderung der Verfahrensvorschriften wurden auch die Brandschutzvorschriften der Musterbauordnung überprüft. Ziele waren dabei die Angleichung der Ländervorschriften, die Berücksichtigung der harmonisierten europäischen Brandschutznormen und der Abbau ungerechtfertigter Hindernisse für den Holzbau auf der Basis von Forschungsvorhaben über die Holzbauweise. x | |||||
| Holzbau Kalender 2002 (Ehlbeck, J.) | Bauphysik | 2/2003 | 107 | Bücher | |
| Herlyn, J. W. | Simulationsmodelle für Gebrauchstauglichkeitsuntersuchungen von Holzbauteilen durch künstliche Bewitterung | Bauphysik | 3/2002 | 157-160 | Fachthemen |
KurzfassungDie Eignung neu entwickelter Holzbauteile oder Holzwerkstoffe ist häufig nur über lang andauernde und entsprechend kostenintensive Praxisversuche nachzuweisen. Die Untersuchungsdauer kann durch Bewitterungssimulationen in Doppelklimaanlagen verkürzt werden. Voraussetzung für eine künstliche Bewitterung ist ein geeignetes Simulationsmodell. In dem Modell müssen die natürlichen Klimabelastungen in der Art nachgestellt werden, daß die Beanspruchungen des Bauteils im Versuch denjenigen in der Natur entsprechen. Zu diesem Zweck sind die Wirkungspfade der Klimabelastungen auf das Holzbauteil aufzustellen. Anschließend wird mit Hilfe des Test Tailoring ein Modell entwickelt, in dem die Belastungen zur Verkürzung der Versuchsdauer zeitgerafft und beschleunigt werden. Hierfür wird ein Computerprogramm zur Berechnung instationärer gekoppelter Wärme- und Feuchteströme in Bauteilen eingesetzt. Die Zeitstraffung und Beschleunigung von Bewitterungsmodellen sind in erster Linie von der Reaktionsgeschwindigkeit des Holzes oder der Holzwerkstoffe bei Feuchteänderungen abhängig. Diese Geschwindigkeit wird von der Geometrie sowie der Feuchteleit- und Feuchtespeicherfähigkeit beeinflußt. Anhand von unterschiedlichen Holzbauteilen werden die jeweils entwickelten Simulationsmodelle mit exemplarischen Ergebnissen vorgestellt. Dabei wird die jeweilige Vorgehensweise zur Entwicklung der Modelle erläutert. Die Simulationsmodelle enthalten neben den Belastungen aus Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte auch Belastungen aus Niederschlag und Sonnenstrahlung. x | |||||
| Gösele, K. | Verbesserung des Schallschutzes von Holzbauteilen durch Schwingungstilger ("akustische Blutegel") | Bauphysik | 2/2002 | 93-1001 | Fachthemen |
KurzfassungIm folgenden wird über einen neuen Effekt berichtet, mit dessen Hilfe bei leichten doppelschaligen Bauteilen, vor allem im Holzbau, durch eingebrachte Dämmschichten eine große Körperschalldämpfung der Schalen erreicht werden kann. Der Effekt beruht darauf, daß man die Dämmschicht so mit den Schalen verbindet, daß sich einzelne Resonatoren innerhalb der Dämmschicht bilden, die zu einem verstärkten Entzug von Körperschall-Energie aus den Schalen führen (Schwingungstilger). x | |||||
| Der Holzbau und die Energieeinsparverordnung Tagungsband zu den Fachtagungn Holzbau 2001 (Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Holz e. V. (argeholz)) | Bauphysik | 1/2002 | 57-58 | Bücher | |
| Integrierter Umweltschutz im Bereich der Holzwirtschaft. Entwicklung und Erprobung neuartiger Löschanlagen für den mehrgeschossigen Holzbau zur Brandbekämpfung und Fluchtwegsicherung (Teil 1 und 2) - Forschungsbericht des Bundesministeriums für Bildung un | Bauphysik | 6/2001 | 358 | Bücher | |
| Lernen aus Schäden im Holzbau - Ursachen, Vermeidung, Beispiele (F. Colling) | Bauphysik | 6/2001 | 379 | Bücher | |