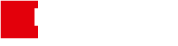| Eisenbach, Philipp; Bollinger, Klaus; Heimrath, Moritz; Prengel, Jon | Schnellladedach Leipzig - Schwebendes Dach auf einer computergenerierten Endlosst√ľtze | Stahlbau | 7/2023 | 407-417 | Berichte |
Für eine Schnellladestation am Produktionsstandort eines Sportwagenherstellers sollte eine Überdachung entwickelt werden, die neben der Funktion als Witterungsschutz das Image der Marke transportiert. Die bereits vorhandene technische Infrastruktur, also nicht überbaubare Starkstromtrassen sowie Bewegungs- und Wartungsräume der Ladesäulen, ließen nur wenige und v. a. unregelmäßige Auflagerpunkte und Stützenstellungen zu. Das Ergebnis des Entwurfsprozesses ist ein scheinbar schwebendes Dach, dessen Verkleidung einer Tragfläche nachempfunden ist, welche auf einer einzigen Endlosstütze aufgelagert wurde. Die Endlosstütze Spline, ikonografisch in Analogie einer zunächst einfach erscheinenden, aufgebogenen Büroklammer, gewährleistet durch die räumlichen Stützenstellungen und -neigungen sowohl die Einspannung des auskragenden Dachs als auch die globale Aussteifung. Unter Einsatz eines evolutionären Optimierungsalgorithmus wurde die Geometrie hinsichtlich größtmöglicher Effizienz unter Einhaltung der gegebenen geometrischen Restriktionen entwickelt. Innerhalb des parametrischen Strukturmodells erfolgte neben der Kontrolle und Analyse der statischen Performance auch die geometrische Durchbildung der gefrästen Kreisbögen an den Kopf- und Fußpunkten. Der gesamte Prozess von der Entwicklung und Variantenstudie über die Analyse und Dokumentation bis zur Fertigung fand somit in einer geschlossenen digitalen Prozesskette statt.
Fast-charging station Leipzig - the floating roof on a computer-generated endless support
For a fast-charging station at the production site of a sports car manufacturer, a roof was to be developed that would transport the image of the brand in addition to I function as weather protection. The existing technical infrastructure, i. e., power lines that could not be built over and movement and maintenance spaces for the charging columns, only allowed for a few and, above all, irregular support points and support positions. The design process results in a seemingly floating roof whose cladding is modelled on an aerofoil supported on a single endless column. The infinite support Spline, iconographically analogous to an initially simple appearing bent-up paper clip, ensures both the clamping of the cantilevered roof and the global reinforcement through the spatial support positions and inclinations. The geometry was developed using an evolutionary optimisation algorithm with the most outstanding efficiency while complying with the given geometric restrictions. Within the parametric structural model, in addition to the control and analysis of the static performance, the geometric implementation of the milled circular arcs at the head and foot points was also carried out. The entire process, from the development and variant study to the analysis and documentation to the production, thus took place in a closed digital process chain. Therefore, it was possible to achieve the design goal of contrasting a flat roof and a filigree support structure. x |
| Wendler, Lea; Löschner, Daniel; Engelhardt, Imke; Telljohann, Gerd; Große-Soetebier, Carsten; Sigmund, Tilo; Neher, Michael | Automatisierte Schweißnahtnachbehandlung durch höherfrequentes Hämmern | Stahlbau | 7/2023 | 418-426 | Aufsätze |
Die Wirksamkeit der Schweißnahtnachbehandlung durch höherfrequente Hämmerverfahren (HFH) zur Steigerung der Ermüdungsfestigkeit wurde bereits durch eine Vielzahl von Studien belegt. Durch die robotergesteuerte Anwendung der HFH-Verfahren soll die Schweißnahtnachbehandlung in den Herstellprozess automatisiert geschweißter Bauteile integriert werden können und ein wirtschaftlicher Einsatz der HFH-Behandlung innerhalb der Serienfertigung ermöglicht werden. Zudem kann eine automatisierte Qualitätskontrolle in den Nachbehandlungsprozess eingebunden werden, die eine genauere Vermessung der Nahtgeometrie als konventionelle Messmethoden ermöglicht. Dieser Beitrag befasst sich mit der gerätespezifischen Entwicklung einer robotergesteuerten Anwendung der HFH-Nachbehandlung mit dem HiFIT-Gerät sowie einer automatisierten Qualitätskontrolle. Anschließend wird die Verifizierung der Wirksamkeit der automatisierten HFH-Nachbehandlung anhand von Ermüdungsversuchen und der Vermessung der Eindruckgeometrie dargestellt.
Automated post weld treatment by High Frequency Impact Treatment
The effectiveness of post weld treatment by High Frequency Mechanical Impact Treatment (HFMI) to increase the fatigue strength has already been proven by numerous studies. An automated application of HFMI-treatment can be integrated in the manufacturing process of automated welded constructions and enables an economical use of HFMI-treatment within series production. Furthermore, an automated quality control can be embedded in a robot-controlled HFMI-process, which enables a more precise measurement of the weld geometry than conventional measuring methods. This article covers the device-specific development of a robot-controlled application of HFMI-treatment by the HiFIT-tool as well as an automated quality control. Following, the verification of the effectiveness of an automated HFMI-treatment by fatigue tests and the measurement of the geometry of the HFMI groove is presented. x |
| Kremberg, Jan; Häßler, Dustin; Stelzner, Ludwig; Hothan, Sascha | Brandversuche an mechanisch belasteten Carbonzuggliedern | Stahlbau | 7/2023 | 428-436 | Aufsätze |
Die Anwendung von Zuggliedern aus Carbon ist durch die außergewöhnlich gute Ermüdungs- sowie hohe Zugfestigkeit des Werkstoffs motiviert. Ferner ergibt sich gegenüber Stahl eine deutliche Reduzierung des Querschnitts. Perspektivisch sollen damit u. a. Stahlzugglieder im Netzwerkbogenbrückenbau ersetzt werden. Das Tragverhalten von Carbonzuggliedern im Brandfall ist jedoch bislang unbekannt. Daher wurden mittels Bauteilbrandversuchen die Versagensmechanismen untersucht sowie anhand gewonnener Versuchsdaten eine exemplarische Einschätzung zur Gleichwertigkeit gegenüber konventionellen Stahlzuggliedern vorgenommen. Der Beitrag beschreibt realmaßstäbliche Brandversuche an mechanisch belasteten Carbonzuggliedern, die im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens NeZuCa durchgeführt wurden. Das Versuchsprogramm umfasste vier Carbonzugglieder mit kreisrunden Querschnitten in zwei verschiedenen Durchmessern, 36 mm und 51 mm. In Ermangelung eines präskriptiven Brandszenarios für den im Projekt vorgesehenen Anwendungsfall und aus Gründen der Vergleichbarkeit erfolgte die Brandbeanspruchung nach Einheitstemperaturzeitkurve (ETK). Neben den Längsverformungen der Zugglieder wurden auch die Bauteil- und Brandraumtemperaturen aufgezeichnet.
Fire testing of loaded carbon tension members
The application of carbon tension members is motivated by extraordinary well fatigue behaviour and high tensile strength of the material. Compared to steel, cross sections can be reduced. Steel tension members used for network arch bridges shall be replaced in perspective. The loadbearing behaviour of carbon tension members in case of fire is still unknown. Therefore, fire tests were performed to investigate the failure mechanisms. Based on the derived test data the comparability to conventional steel tension members was estimated. This paper describes real scale fire testing of mechanically loaded carbon tension members, carried out as a part of the joint research project NeZuCa. The test setup consisted of four carbon tension members with circular cross sections and diameters of 36 mm and 51 mm. In absence of a prescriptive fire scenario for the application case intended in the research project and to ensure comparability, a fire exposure according to standard temperature/time curve was chosen. The elongation of the tension members as well as the temperatures of the specimen and the furnace were recorded. x |
| Gap height prediction for bolted ring flange connections based on measurements | Stahlbau | 7/2023 | 436 | Empfehlungen der Redaktion |
No short description available. x |
| Haspel, Lorenz; Ebentheuer Barcel√≥, Jan; Krenn, Burkhard; Oevermann, Paul; Fettke, Manuela; Schneider, Lukas; Weidner, Philipp; Ruff, Daniel C.; Ummenhofer, Thomas; Birtel, Veit; Castridis, Stefan; Lotze, Dieter; Abrishambaf, Amin; H√ľckler, Alex; Schlaich, Mike | Carbonzugglieder unter statischer und nicht ruhender Beanspruchung - Erste Ergebnisse aus dem Forschungsverbundvorhaben NeZuCa | Stahlbau | 7/2023 | 437-452 | Aufs√§tze |
Um eine ausreichende Verfügbarkeit der Brückeninfrastruktur gewährleisten zu können, werden Lösungen benötigt, welche den hohen Verkehrsbeanspruchungen dauerhaft zuverlässig standhalten und gleichzeitig durch Ressourcenschonung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Das Prinzip der Netzwerkbogenbrücke erlaubt effiziente und verformungsarme Brückentragwerke mit Spannweiten bis über 300 m unter Einsatz von schlanken, vorwiegend normalkraftbeanspruchten Haupttraggliedern. Der Einsatz des Hochleistungswerkstoffs Carbon (unidirektionale Carbon Fiber Polymer Composite, UD-CFPC) erlaubt eine äußerst leistungsfähige Leichtbaulösung für hoch beanspruchte Zugglieder und eröffnet zudem Einsparpotenziale im Primärtragwerk. Carbonzugglieder sind gegenwärtig nicht bauaufsichtlich geregelt. Als Grundlage für eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) wurden für erste Anwendungen durch den jeweiligen Bauherrn finanzierte projektspezifische Bauteilversuche herangezogen. Durch Bauteilversuche unter statischer und nicht ruhender Beanspruchung sowie ergänzende Untersuchungen sollen im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens NeZuCa (Netzwerkbogenbrücken mit Zuggliedern aus Carbon) die Grundlagen für eine standardisierte und vereinfachte Anwendung der Technologie erarbeitet werden. In diesem Beitrag berichtet das Projektkonsortium über erste Ergebnisse. NeZuCa wird als Teil des Technologietransferprogramms Leichtbau (TTP-LB) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und durch den Projektträger Jülich (PTJ) betreut.
Tension member made from carbon fiber polymer composite subject to static and fatigue loads - first results from joint research project NeZuCa
For high availability of bridge infrastructure, solutions are needed that can withstand high traffic loads reliably and contribute to climate protection through resource savings. The principle of the network arch bridge allows for efficient and low-deformation bridge structures with spans of over 300 m, using slender primarily axially loaded main members. The use of high-performance carbon materials (unidirectional carbon-fibre-reinforced polymers, UD-CFRP) allows for an extremely efficient lightweight solution for highly stressed tension members and offers potential savings in the primary structure. Carbon tension members are currently not regulated by building authorities. For the basis of an individual approval (ZiE), project-specific component tests financed by the respective client were used for initial applications. Within the framework of the joint research project NeZuCa (Network Arch Bridges with Carbon Tension Members), component tests under static and non-static loading conditions, as well as additional investigations, are conducted to establish the basis for a standardized and simplified application of the technology. This article presents the initial results reported by the project consortium. NeZuCa is supported by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy as part of the Lightweight Construction Technology Transfer Program (TTP-LB) and is supervised by the Project Management Agency Jülich (PTJ). x |
| A consistent approach for global buckling of steel structures | Stahlbau | 7/2023 | 452 | Empfehlungen der Redaktion |
No short description available. x |
| Lang, Robert; Klapper, Georg; Klien, Thomas | Ein moderner Kran f√ľr alten Schrott am Werksgel√§nde der Badischen Stahlwerke GmbH (BSW) | Stahlbau | 7/2023 | 453-460 | Berichte |
Mit der Fertigstellung des neuen Schrottverladekrans am Werksgelände der Badischen Stahlwerke GmbH steht ein moderner Umschlagkran zum Schrott-Handling zur Verfügung. Mit einer Gesamtlänge von 100 m und einer Gesamthöhe von über 30 m besticht der Kran nicht nur optisch, sondern in vielen Bereichen mit außergewöhnlichen Detaillösungen. Der patentierte runde Hauptträger ist die sichtbarste Komponente, die neue Maßstäbe setzt. Doch auch andere Teile des Stahlbaus sowie die Maschinenkomponenten sind am Stand der Technik und runden Konstruktion und Funktion ab. x |
| A Eurocode-compliant design approach for cold-formed steel sections | Stahlbau | 7/2023 | 460 | Empfehlungen der Redaktion |
No short description available. x |
| Stahlbau aktuell 7/2023 | Stahlbau | 7/2023 | 461-464 | Stahlbau aktuell |
Aktuelles:
Erzeugerpreisindex Stahl (2015 = 100)
Durchschnittliche BDSV-Lagerverkaufspreise für Stahlschrottsorten in Deutschland
Internationaler Ringversuch zu numerischen Schalenbeulsicherheitsnachweisen
Wettbewerbe:
Verleihung des Züblin-Stahlbaupreises 2023 x |
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Stahlbau | 7/2023 | 465 | Veranstaltungskalender |
No short description available. x |
| Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 7/2023 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 7/2023 | 1-44 | Gesamtausgabe |
No short description available. x |
| Titelbild: Bautechnik 6/2023 | Bautechnik | 6/2023 | | Titelbild |
Zum Titelbild:
Im Dezember 2015 wurde die historische Friesenbrücke durch einen Schiffsanprall zerstört. Dabei wurde der bewegliche Brückenteil, eine Scherzer-Klappbrücke so stark beschädigt, dass eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr möglich war. Für den Ersatzneubau fiel die Wahl auf die Variante einer Hub-Drehbrücke mit einer Spannweite von ca. 143 m und einer Gesamtlänge von 337 m. Die neue Hub-Dreh-Brücke ermöglicht eine lichte Schifffahrtsöffnung von 56,60 m. Neben den Anforderungen an einen sicheren Eisenbahnbetrieb mit Anbindung an das Netz der niederländischen Eisenbahninfrastruktur im Zuge der Ausbaubestrebungen in Richtung Groningen wurden alle Anforderungen der Wasserstraße zur Aufrechterhaltung der “Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs” erfüllt.
Das Bild zeigt oben die Scherzer Klappbrücke von 1926, unten die neu geplante Hub-Dreh-Brücke. (Fotos: Marx Krontal Partner | Abdul Atiq) Siehe Bericht S. 334
x |
| Inhalt: Bautechnik 6/2023 | Bautechnik | 6/2023 | | Inhalt |
No short description available. x |
| Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: Wohnungsbau 2023 | Bautechnik | 6/2023 | 1-52 | Sonderheft |
No short description available. x |
| Monka-Birkner, Johanna; Rein√§cker, Moritz; Krafczyk, Christina; Knufinke, Ulrich; Marx, Steffen | Denkmalgesch√ľtzte Eisenbahnbr√ľcken - Potenziale f√ľr das nachhaltige Bauen | Bautechnik | 6/2023 | 291-298 | Aufs√§tze |
Historische Eisenbahnbrücken stehen aufgrund ihrer bautechnikgeschichtlichen Bedeutung und der Anforderung nach Erneuerung immer wieder im Spannungsfeld zwischen Denkmalpflege und Baupraxis; das erklärte Ziel aller Beteiligten sollte es aber sowohl aus der Perspektive des kulturellen Erbes als auch aus der der Ressourcenökonomie sein, sie zu erhalten und weiter zu nutzen. Es wird herausgestellt, dass historische Eisenbahnbrücken im Kontext ihres Netzes zu betrachten sind, da ihre primäre Funktion die Überführung einer Strecke darstellt. Aufgrund dieser Funktion ist ein notwendiges Maß an Veränderbarkeit auch bei jenen Eisenbahnbrücken zu gewährleisten, die unter Denkmalschutz stehen. Durch die notwendigen Veränderungen müssen immer wieder Brücken ersetzt werden. Dabei ist auffällig, dass die Struktur der erneuerten Bauweisen in ihrer konstruktiven und gestalterischen Diversität abnimmt. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit sollten Eisenbahnbrücken geschützt und gleichzeitig veränderbar sein, damit die einzelnen Bauwerke möglichst lange erhalten bleiben. Schonung von Ressourcen durch Erhaltung statt Abbruch und Neubau können Hand in Hand mit den Zielen der Denkmalpflege gehen, wenn dabei materielle und ideelle Ressourcen für kommende Generationen erhalten bleiben. Die drei Kriterien der Nachhaltigkeit werden hier für den Eisenbahnbrückenbau überprüft. Abschließend werden Beispiele für eine erfolgreiche Erhaltung und eine gelungene Erneuerung aufgezeigt.
Listed railway bridges - potential for sustainable construction
Due to their relevance to the history of construction and the need for renewal, historic railway bridges are often in conflict between the preservation of historical monuments and construction practice. But the declared aim is to preserve them and continue to use them. It will be shown why it is necessary to consider historic railway bridges in the context of their network. This is because their primary function is the overpassing of a line. Due to this function, a necessary degree of changeability of (listed) railway bridges has to be ensured. The necessary changes mean that bridges have to be replaced again and again, and it is noticeable that the structure of the renewed construction methods is decreasing in diversity. Also in terms of sustainability, railway bridges should be protected and at the same time changeable. In this way, the individual structures can be preserved for as long as possible. Conservation of resources through preservation instead of demolition and new construction go hand in hand with the goals of heritage conservation to preserve material and ideal resources for future generations. The three criteria of sustainability are reviewed here for railway bridge constructions. Finally, examples of successful preservation and successful renovation are shown. x |
| Grunert, G√ľnther; Behnke, Ronny; Liu, Xiaohan | Dynamische Zug-Br√ľcken-Kompatibilit√§t: Das Referenzverfahren als neue Nachweisform | Bautechnik | 6/2023 | 299-309 | Aufs√§tze |
Neu entwickelte Schienenfahrzeuge sind vor ihrem Einsatz auf dem Schienennetz der DB Netz AG hinsichtlich dynamischer Brückenkompatibilität zu untersuchen. Hierbei wird die dynamische Einwirkung auf Brücken aus Zugüberfahrt (Zug-Brücken-Interaktion) anhand von dynamischen Berechnungsergebnissen im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) und im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) bewertet und mit rechnerischen (bisher statischen) Mindestkapazitäten der Infrastruktur (Widerstand) verglichen. In diesem Beitrag wird eine neue Nachweisform vorgestellt, welche ermöglicht, die vorhandenen statischen Kapazitäten der Brücken um vorhandene dynamische Kapazitäten zu erweitern. Diese erlauben i. d. R. höhere zulässige Fahrzeuggeschwindigkeiten im Netz. Hierfür wird auf rechnerische Ergebnisse und datenbankgestütztes Expertenwissen (Fusion) aus Kurz- und Langzeitüberwachungen von Bestandsfahrzeugen und deren Einwirkung auf die Infrastruktur zurückgegriffen, um den Brückenbestand für diese Bestandsfahrzeuge als betriebserprobt zu erklären. Auf dieser Basis ist eine ansetzbare dynamische Kapazität für Neufahrzeuge formulierbar. Das Vorgehen wird exemplarisch für den ICE 3 (Bestandsfahrzeug) und die Neuentwicklung der Baureihe (BR) 408 (ICE 3neo) gezeigt.
Dynamic train-bridge compatibility: the reference method as a new form of verification
Newly developed rail vehicles must be investigated regarding dynamic bridge compatibility before they are placed in service on the rail network of DB Netz AG. In this context, the dynamic effect on bridges from passing trains (train-bridge interaction) is evaluated based on dynamic calculation results in the ultimate limit state (ULS) and in the serviceability limit state (SLS) and compared with calculated (previously static) minimum capacities of the infrastructure (resistance). In this paper, a new form of verification is presented. It makes it possible to extend the existing static capacities of the bridges by existing dynamic capacities, which usually allow higher permissible vehicle speeds in the railway network. For this purpose, computational results and database-supported expert knowledge (fusion) from short- and long-term monitoring of existing vehicles and their impact on the infrastructure are used to declare the bridge stock for these existing vehicles as operationally verified. On this basis, an applicable dynamic capacity for new vehicles can be formulated. The procedure is exemplarily shown for the ICE 3 (existing vehicle) and the new development of the BR 408 series (ICE 3neo). x |
| Morgenthal, Guido; Helmrich, Marcel | Bildbasierte Erfassung und digitale Dokumentation von Geometrie und Zustand an Eisenbahnbr√ľcken | Bautechnik | 6/2023 | 310-317 | Berichte |
Die kontinuierliche Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Bauwerken der Verkehrsinfrastruktur hat in einer modernen Gesellschaft einen besonderen Stellenwert. Die Bedeutung des Schienennetzes nimmt im Kontext der Energiewende weiter zu. Forderungen nach Ressourcenschonung im Bausektor erfordern zukünftig außerdem deutlich verlängerte Lebensdauern von Bauwerken. Neue digitale Erhaltungsstrategien können dieses Ziel gleichzeitig mit einer Verringerung der Erhaltungsaufwendungen erreichbar machen. Dieser Beitrag fokussiert auf neuartige Verfahren der Bilddatenauswertung zur Zustandsermittlung und digitalen Modellierung von Geometrie und Schadensmerkmalen an Ingenieurbauwerken. Insbesondere die dauerhafte Speicherung von hochgenauen Schadenspositionen und -umfängen erlaubt die Verfolgung von Schadensentwicklungen als Basis für neuartige prädiktive Erhaltungsstrategien. Am Beispiel von Eisenbahnbrücken wird gezeigt, wie eine hochwertige digitale Zustandsdokumentation mit dem Konzept des Digitalen Zwillings möglich wird. Aus z. B. mit Drohnen erzeugten Bilddaten werden mittels Fotogrammetrie hochgenaue georeferenzierte 3D-Bauwerksmodelle generiert und mittels KI-Verfahren Schadenserkennungen durchgeführt. Die Verknüpfung in einem Digitalen Zwilling ermöglicht Analysen und hochwertige Dokumentationen im Lebenszyklus und sollte zukünftig mit einer Nullmessung an neuen Bauwerken beginnen.
Image-based acquisition and digital documentation of geometry and condition of railway bridges
The continuous safety and performance of infrastructure structures is of particular importance for a modern society. The rail network becomes increasingly relevant in the context of the energy transition. Demands for resource efficiency in the construction sector will require significantly longer service lives for structures in the future. New digital maintenance strategies can make this goal achievable while reducing maintenance expenditures at the same time. This report focuses on new image-based methods for condition assessment and digital modelling of the geometry of structures as well as damage characteristics. In particular, the permanent storage of highly accurate damage position and extent information allows the tracking of damage propagation as a basis for novel predictive maintenance strategies. Using the example of railway bridges, it is shown how high-quality digital condition documentation is possible with the concept of digital twins. Photogrammetry is used to generate highly accurate geo-referenced 3D building models from image data acquired by drones, for example, and AI processes are used to perform automated damage detection. The linking in a digital twin enables analyses and high-quality documentation over the life cycle and should start with an initialization measurement on new structures. x |
| Steffen, Sascha; Niemann, Peter; Gei√üler, Karsten | Erl√§uterungen zur aktuell √ľberarbeiteten Richtlinie 805 zur Bewertung von Ingenieurbauwerken der Deutschen Bahn | Bautechnik | 6/2023 | 318-333 | Berichte |
Für die Nachrechnung und Bewertung von Eisenbahnbrücken hat sich die seit ca. 30 Jahren angewandte Richtlinie 805 sehr gut bewährt. Im Rahmen der aktuellen, durch die DB Netz AG vorgenommenen Überarbeitung der Richtlinie wird eine gewisse Angleichung an die europäischen Normen, insbesondere bei den charakteristischen Werten, Sicherheitsfaktoren und Kombinationsbeiwerten angestrebt. Allerdings muss sehr sensibel mit den normativen Regelungen umgegangen werden, da eine “Neubauvorsorge” für die Bestandsbewertung nicht möglich und auch nicht notwendig ist - im Gegenteil, diese würde zu volkswirtschaftlich relevanten Fehlbewertungen von Bauwerken mit ausreichender Zuverlässigkeit führen. Im vorliegenden Beitrag werden zu den einzelnen Modifikationen der Richtlinie 805 hinsichtlich Festlegungen von Einwirkungen, Sicherheitselementen sowie Nachweisen im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Ermüdung die wesentlichen Hintergründe erläutert.
Background to the modifications of guideline RiL 805 for recalculation and assessment of railway bridges in Germany
For the recalculation and evaluation of railway bridges, guideline RiL 805, which has been used for around 30 years, has proven itself very well. As part of the current revision of the guideline carried out by DB Netz AG, a certain adjustment to the European standards is aimed for, in particular with regard to the characteristic values, safety factors and combination coefficients. However, the normative regulations have to be dealt with very sensitively, since a “new building precaution” is neither possible nor necessary for the evaluation of the existing building - on the contrary, this would lead to economically relevant incorrect evaluations of buildings with sufficient reliability. This article explains the essential background to the individual modifications of guideline RiL 805 with regard to the definition of actions, safety elements and verifications in the limit state of load-bearing capacity and fatigue. x |
| Schacht, Gregor; K√∂gel, Jens; Schwede, Stefan; Heinemann, Alexander; Haase, Georg | Die Neue Friesenbr√ľcke bei Weener - Entwurf der gr√∂√üten Hub-Drehbr√ľcke Europas | Bautechnik | 6/2023 | 334-343 | Berichte |
Im Dezember 2015 wurde die historische Friesenbrücke durch einen Schiffsanprall zerstört. Dabei wurde der bewegliche Brückenteil, eine Scherzer-Klappbrücke, so stark beschädigt, dass eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr möglich war. Die DB Netz AG hat die ARGE Friesenbrücke damit beauftragt, verschiedene Varianten eines 1:1-Ersatzes und einer Erneuerung der Brücke zu untersuchen. Unter Beachtung aller Randbedingungen fiel die Wahl auf die Erneuerung der Friesenbrücke als Hub-Drehbrücke mit einer Spannweite von ca. 143 m. Die Friesenbrücke hat eine Gesamtlänge von 337 m und überführt die eingleisige Strecke von Ihrhove nach Nieuweschans (NL). Die neue Hub-Drehbrücke ermöglicht eine lichte Schifffahrtsöffnung von 56,60 m. Neben den Anforderungen an einen sicheren Eisenbahnbetrieb auf einer eingleisigen Strecke mit Anbindung an das Netz der niederländischen Eisenbahninfrastruktur im Zuge der Ausbaubestrebungen in Richtung Groningen waren bei der Neuplanung insbesondere die Gegebenheiten zu berücksichtigen, welche sich zusätzlich aus den Anforderungen der Wasserstraße aus der Einhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs ergeben. Die schwierigen Baugrund- und Wasserbedingungen auf der tideabhängigen Seeschifffahrtsstraße erfordern zum Teil aufwendige Baubehelfe, Sicherungsmaßnahmen und große Flusspfeiler.
The new Friesen bridge near Weener - design of Europes largest lift-swing-bridge
The historic Friesen bridge was destroyed by a ship impact in December 2015. The movable bridge part, a rolling bascule bridge (Scherzer bridge) was totally destroyed and excluded the possibility of an economic rehabilitation. The ARGE Friesenbrücke was engaged by the DB Netz AG to investigate possible solutions of an one-to-one replacement and a new movable bridge construction. In compliance with all registrations the DB choose the design of a lift-swing bridge with a span of 143 m. The new Friesenbrücke has a total length of 334 m and carries the single track from Ihrhove to Nieuweschans (NL). The new lift-swing-bridges enables an opening width of 56.60 m. This opening width fulfils the requirements of the safety and lightness of the ship traffic and also allows a safe railway traffic and the connection to the network of the Dutch railway infrastructure. The difficult geotechnical conditions and the river Ems with tidal waters required sophisticated temporary construction, safety measures and large river piers. x |
| Mechanische Aktivierung von Lehm | Bautechnik | 6/2023 | 343 | Empfehlung der Redaktion |
No short description available. x |
| Steiner, Daniel; Sprenger, Bjarne | Moderne Konzepte im Massivbau - √ľber Potenziale von Methoden der k√ľnstlichen Intelligenz | Bautechnik | 6/2023 | 344-350 | Berichte |
Frau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martina Schnellenbach-Held zur Vollendung des 60. Lebensjahres gewidmet
Die Anwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz bietet vielfältiges und vielversprechendes Potenzial für die Entwicklung innovativer Konzepte in Forschung und Praxis. Zur Darstellung der erschließbaren Möglichkeiten werden ausgewählte Methoden und moderne Konzepte aus dem Bereich des Massivbaus vorgestellt. Adaptiv vorgespannte Betontragwerke wurden mit lernfähigen Regelungsalgorithmen auf Basis der Fuzzy Logic realisiert. Für eine kontinuierliche Brückenüberwachung wurde ein Monitoringkonzept erarbeitet, das eine Modelladaption mittels evolutionärer Algorithmen und eine Zuverlässigkeitsbewertung mit künstlichen neuronalen Netzen umfasst. Für eine effiziente Unterstützung des Vorentwurfs von Gebäuden wurde ein wissensbasiertes System entwickelt, das die Erfassung und Bereitstellung von Ingenieurwissen durch scharfe und unscharfe Wissensbanken sowie der Possibilitätstheorie leistet. Diese modernen Konzepte im Massivbau unterstreichen wesentliche Potenziale des Einsatzes von Methoden der künstlichen Intelligenz.
Modern concepts in concrete engineering - about the application of artificial intelligence methods
The application of artificial intelligence methods provides manifold and promising capabilities to develop innovative concepts in science and practice. Selected methods and modern concepts from the field of concrete construction are presented to outline achievable possibilities. Adaptive prestressed concrete structures were realized using Fuzzy Logic-based self-tuning closed-loop control algorithms. A monitoring concept for continuous structural health monitoring of bridges was elaborated that comprises a model adaptation through evolutionary algorithms and artificial neural networks for reliability validations. For an efficient support of preliminary building design, a knowledge-based system has been developed that enables the formalization and provision of engineering knowledge through crisp and fuzzy knowledge bases and possibility theory. These modern concepts in concrete construction underline substantial potentials that are achievable through the application of artificial intelligence methods. x |
| Bautechnik aktuell 6/2023 | Bautechnik | 6/2023 | 351-356 | Bautechnik aktuell |
Nachrichten:
Geiseltalsee ist “Lebendiger See des Jahres 2023”
Werner Sobek mit der Emil-Mörsch-Denkmünze des DBV ausgezeichnet
Bauen mit Stahl - Eine Geschichte des Schweizer Stahlbaus
Wettbewerbe:
DBV verleiht Rüsch-Forschungspreis 2023
Firmen und Verbände:
Führungswechsel an der DGfM-Spitze
Zuschrift:
Seibel, E.; Vrettos, C.; Hettler, A. (2022) Bewertung der Nachweiskonzepte nach EC7 für Baugrubenwände in Sand auf Grundlage der Finite-Elemente-Methode. Bautechnik 99, H. 12, S. 865-877
Bewertung der Nachweiskonzepte nach EC7 für Baugrubenwände in Sand auf Grundlage der Finite-Elemente-Methode x |
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bautechnik | 6/2023 | 356 | Veranstaltungskalender |
No short description available. x |
| Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 6/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2023 | | Titelbild |
Zum Titelbild:
Hybride Tragstrukturen des Stahl-, Beton- und Verbundbaus können einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Ressourceneffizienz leisten, wenn die Baustoffe Beton und Stahl funktionsgerecht und effizient eingesetzt werden. So geschehen z. B. beim Neubau der Berufsschulen für Farben und Gestaltung in München (BSCW). Die beiden sichtbaren und markanten Stahlfachwerkträger überspannen im Erdgeschoss mit rund 30 m die Zweifachsporthalle und tragen gleichzeitig die Lasten aus fünf Geschossen darüber ab. Die Verbundträgerdecke über der Sporthalle ist am Untergurt nach oben gehängt. Das hybride Tragwerk aus Verbundträgerdecken und wandartigen Trägern aus Sichtbeton zeichnet sich durch seine integrale und materialeffiziente Bauweise aus. Der Beitrag auf S. 437-445 gibt Einblicke in die Tragwerksfindung, numerische Modellbildung, wichtige Meilensteine der Baustelle sowie Überlegungen zu Ressourceneffizienz und zirkulärem Bauen mit Verbundkonstruktionen. (Bild: Fa. Hönninger)
x |
| Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 6/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 6/2023 | | Inhalt |
No short description available. x |