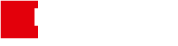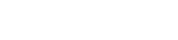Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelsmann, Stephan; Peters, Stefan; Dengler, Christoph; Streib, Johannes | Jugendherberge Bayreuth: konzeptionell innovativ und tragstrukturell hybrid | Bautechnik | 1/2019 | 48-57 | Berichte |
KurzfassungDer Neubau der Jugendherberge Bayreuth ist ein Vorzeigeprojekt der Modernisierungs- und Erneuerungsstrategie des Deutschen Jugendherbergswerks. Er ist Bestandteil eines Gesamtkonzepts zur Entwicklung von architektonisch und sozial zeitgemäßen Jugendgästehäusern, das in Form von prototypischen Bauwerken umgesetzt werden und Ausgangspunkt für eine neue Generation von Jugendherbergsgebäuden sein soll. Ziel des Konzepts ist eine funktional und gestalterisch anspruchsvolle Neuinterpretation der Bauaufgabe Jugendherberge. Insbesondere gehören zu dieser Strategie innovative räumliche Konfigurationen, Nachhaltigkeit in funktionaler, baulicher und energetischer Hinsicht sowie die Verbindung von kulturellen und sportlichen Angeboten. Das Tragwerk des Gebäudes ist im Sinne dieser übergeordneten Planungsziele in einer Hybridbauweise aus Holz und Stahlbeton gebaut. In tragwerksplanerischer Hinsicht bemerkenswert sind insbesondere eine geometrisch komplexe, doppelt gekrümmte Dachkonstruktion in Holzbauweise und der Einsatz von parametrischen Planungswerkzeugen. x | |||||
| Rug, W. | 12. Holzbauseminar. | Bautechnik | 1/1997 | 48-49 | Berichte |
| Trautz, Martin; Seiter, Alex | Der Luisenturm auf dem Atzelberg | Stahlbau | 1/2023 | 49-53 | Berichte |
KurzfassungIm Zuge der Errichtung eines Ersatzneubaus des Luisenturms auf dem Atzelberg bei Kelkheim-Eppenhain im Taunus löst eine Stahlkonstruktion den bisherigen Aussichtsturm in Holzbauweise ab. Das 27 m hohe Bauwerk zeichnet sich durch schlanke Tragelemente aus geradlinigen und gekrümmten Stahlrohren aus, die in Off-Knot-Bauweise hergestellt und gefügt sind, wobei sich die Stoßstellen außerhalb der Stabwerksknoten befinden und so die komplett geschweißten Knoten frei bleiben von zusätzlichen Laschen, Stoßdeckungen und Verschraubungen. Die Rohrfügungen bestehen aus vierteiligen, passgeformten Laschen aus Rundrohrausschnitten, die im Inneren angeschraubt werden und nur an der Stoßfuge und den außenliegenden Schraubenköpfen erkennbar sind. Die neuartige Konstruktionsweise unterstreicht die Filigranität des Tragwerks und setzt einen eleganten Akzent in die umgebende gebirgige Taunuslandschaft. x | |||||
| Rug, W. | 9. Holzbauseminar. | Bautechnik | 1/1992 | 50-51 | Berichte |
| Kübler, Wolfram | Das neue Elefantenhaus im Zoo Zürich | Bautechnik | 1/2014 | 51-57 | Berichte |
KurzfassungIntegriert in einen Landschaftspark soll das neue Elefantenhaus im Zoo Zürich nicht als technischer Zweckbau erscheinen. Das Schalentragwerk wurde mittels statischer Formfindung entwickelt. Die Holzkonstruktion besteht aus mehrlagigem Aufbau, damit die Materialeigenschaften Anisotropie sowie Festigkeits- und Steifigkeitsverhalten in Abhängigkeit vom Kraftfaserwinkel egalisiert werden und eine duktile und robuste Konstruktion entsteht. Obwohl die 271 geometrisch völlig unterschiedlichen und spitzwinkligen Oblichter mit bis zu 40 m2 Größe keine Regelmäßigkeit vermuten lassen, kann die Konstruktion auf zwei Regelschnitte reduziert werden. x | |||||
| Duy, W. | Einfluss des Wölbwiderstands auf die Kippsicherheit von gabelgelagerten Holzbalken. | Bautechnik | 2/1988 | 51-57 | |
KurzfassungKippuntersuchungen von gabelgelagerten Holzträgern mit h/b > 10 sind unnötig, wenn der Druckgurt von Rechteckquerschnitten im Abstand von a=15 x b bzw. von Sandwichquerschnitten, z.B. von Fachwerkträgern, im Abstand von a=11 x b seitlich unverschieblich gehalten ist. Diese Forderungen stehen im Widerspruch zu bisherigen Festlegungen, wo infolge der verschiedener Annahmen (keine Wölbsteifigkeit, Biegedruckspannungen begrenzt) sich andere Festlegungen zu den erforderlichen Abständen der Kipphalterungen ableiten lassen. Unter Berücksichtigung der Wölbsteifigkeit ergibt sich jedoch wieder eine gute Übereinstimmung. x | |||||
| Dietsch, Philipp; Sandhaas, Carmen; Ruff, Daniel; Ummenhofer, Thomas | 100 Jahre Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine Karlsruhe | Bautechnik | 1/2023 | 55-61 | Berichte |
KurzfassungDie Berufung von Prof. Dr.-Ing. Ernst Gaber an die Technische Hochschule Karlsruhe im Jahr 1921 markierte den Startschuss des Prüfraums Gaber, aus dem später die Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine hervorging. Heute ist die Versuchsanstalt Teil des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und besteht aus den Abteilungen Holzbau und Baukonstruktion sowie Stahl- und Leichtbau. Der folgende Beitrag blickt auf die Geschichte dieser Einrichtung zurück. x | |||||
| Schwar, A. | Das Tragverhalten von beanspruchten Brettsperrholzplatten unter dem Einfluß streuender Jahrringorientierungen der Querlagen | Bautechnik | 1/2006 | 56-61 | Fachthemen |
KurzfassungBei Beanspruchungen rechtwinklig zur Plattenebene treten unter bestimmten Bedingungen (kleine Stützweiten, kurze Distanzen zwischen Auflager und Krafteinleitung, etc.) hohe Rollschubbeanspruchungen in den querorientierten Brettlagen auf. Das Verformungs- und Versagensverhalten der gesamten Brettsperrholzplatte ist somit stark von den Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der querorientierten Brettlage abhängig, welche wiederum durch Rohdichte, Imperfektionen (zB. ste, Risse) sowie die unterschiedlichen Jahrringorientierungen der einzelnen Bretter beeinflußt werden. In diesem Aufsatz wird eine FE-Simulation vorgestellt, welche es erlaubt, die bis zum vollständigen Versagen der Platte nacheinander auftretenden Brüche lokal zu identifizieren. Zur Beschreibung der unterschiedlichen Jahrringorientierungen werden hierbei probabilistische Eingangsgrößen verwendet. Die berechneten globalen Last-Verschiebungskurven werden anschließend mit denen aus Bauteilversuchen in Originalgröße verglichen und diskutiert. Ein Verstehen der sukzessiven Bruchabfolge bei Beanspruchung rechtwinklig zur Plattenebene ermöglicht gezielte Konstruktionsverbesserungen. x | |||||
| Der Holzbau und die Energieeinsparverordnung Tagungsband zu den Fachtagungn Holzbau 2001 (Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Holz e. V. (argeholz)) | Bauphysik | 1/2002 | 57-58 | Bücher | |
| Werther, N.; Winter, S. | Klimatische Verhältnisse in Kriechkellern unter gedämmten Holzbodenplatten | Bauphysik | 2/2009 | 59-64 | Fachthemen |
KurzfassungHochgedämmte Holzbodenplatten über Kriechkellerkonstruktionen als unterer Abschluss eines Gebäudes kamen in den letzten Jahren im Bereich des Wohn- und Zweckbaus in Holzbauweise vermehrt zur Anwendung. Fehlende Kenntnis zu den im Kellerbereich herrschenden Mikroklimabedingungen und die sich daraus ergebenden Nutzungsrandbedingungen für Holz und Holzwerkstoffe führten zu unterschiedlichen Konstruktionsformen. Mittels Langzeitmessungen im Feld- und Laborversuch wurden Konstruktionsprinzipien entwickelt, die einen dauerhaften Einsatz von Holzbodenplatten über belüfteten Kriechkellern sicherstellen. x | |||||
| Franke, B.; Franke, St.; Rautenstrauch, K. | Beanspruchungsanalyse von Holzbauteilen durch 2D-Photogrammetrie | Bautechnik | 2/2005 | 61-68 | Fachthemen |
KurzfassungFür die Bewertung der Tragsicherheit von Bauteilen aus Voll- und Brettschichtholz in Lasteinleitungs- und Störbereichen mittels der Bruchmechanik ist die Kenntnis von kritischen Bruchkennwerten Voraussetzung. Realitätsnahe Kennwerte können aus der Kombination experimenteller Untersuchungen zur Bestimmung der Rißaufweitung und der Rißlänge mit daran anschließender FE-Simulation gewonnen werden. Aufgrund der bisher bei konventionellen Meßverfahren nicht ausreichenden Zuordnung der Meßwerte taktil applizierter Meßaufnehmer lag es nahe, das Rißwachstum mit Hilfe der Photogrammetrie zu untersuchen. Mit dem entwickelten Meßsystem ist nunmehr die Möglichkeit der exakten Vermessung der Rißgeometrie zur Bestimmung von bruchmechanischen Kennwerten gegeben. Zusätzlich ermöglicht der Einsatz der Photogrammetrie die Verdichtung der Anzahl variierender diskreter Meßpunkte, so daß ein deutlich vollständigeres Bild der örtlichen Verformungen gewonnen und damit die Aussagekraft eines Versuchs wesentlich verbessert werden kann. x | |||||
| Dutko, P. | Berechnung der Durchbiegung aus Querkraft bei geleimten Holzträgern. | Bautechnik | 2/1969 | 63-66 | |
KurzfassungEs wird für geleimte Vollwandträger mit offenem oder geschlossenem Querschnitt der Durchbiegungsanteil infolge der Querkraft bestimmt. x | |||||
| Tywoniak, Jan; Volf, Martin; Bure , Michal; Lupí ek, Antonín; Stan k, Kamil | Vorhangfassade auf Holzbasis - eine komplexe bauphysikalische Aufgabe | Bauphysik | 1/2017 | 64-69 | Fachthemen |
KurzfassungDer Beitrag befasst sich mit der Entwicklung einer Systemlösung für den Ersatz alter nichttragender Außenwände bei Nichtwohngebäuden aus den 1960er und 1970er Jahren. Die Hauptidee war, ein vorgefertigtes Produkt in moderner Holzbauweise zu entwickeln, um eine Alternative zu üblichen Metallbausystemen anzubieten. Es wurde bestätigt, dass ohne detaillierte bauphysikalische Analysen und Messungen eine erfolgreiche Entwicklung kaum möglich ist. Dieser Beitrag befasst sich mit Wärmeschutz und Umweltperformance. Ergebnisse des langfristigen Monitorings und weitere wichtige bauphysikalische Aspekte (Feuchteschutz, Bauakustik, Brandschutz) werden zu einem späteren Zeitpunkt behandelt. x | |||||
| Hauser, G.; Stiegel, H. | Pauschalierte Erfassung der Wirkung von Wärmebrücken | Bauphysik | 3/1995 | 65-68 | Fachthemen |
KurzfassungDie Wirkung von Wärmebrücken kann zwar mittels geeigneter Rechenprogramme oder Verwendung von Wärmebrücken-Atlanten quantifiziert werden, jedoch ist damit ein erheblicher Aufwand verbunden. Mit Hilfe einer pauschalen Erfassung der Wirkung von Wärmebrücken in Abhängigkeit von der verwendeten Baukonstruktion soll eine grobe Beschreibung der Wärmebrückenwirkung ermöglicht werden. Zur Beschreibung wird ein Wärmebrückenkorrekturwert vorgeschlagen, um den der mittlere Wärmedurchgangskoeffizient der wärmetauschenden Hüllfläche zu erhöhen ist. Aus der Untersuchung eines konkreten Einfamilienhauses sowie synthetischer Gebäude mit variablen Raummodulen werden je nach Bauart Wärmebrückenkorrekturwerte von 0,2 für die Massivbauart und 0,1 für die Holzbauart bei Verwendung von Innenmaßen und von 0,14 bzw. 0,03 W/(m²K) bei Verwendung von Außenmaßen abgeleitet. x | |||||
| Datenaustausch im Stahl- und Holzbau | Stahlbau | 1/2006 | 67 | Nachrichten | |
| Firmen und Verbände | Bautechnik | 1/2009 | 68-70 | Nachrichten | |
Kurzfassung- VDI-Richtlinie Fabrikplanung - Planungsvorgehen x | |||||
| Rug, W. | Holzbau in den neuen Ländern. | Bautechnik | 1/1995 | 69-72 | Berichte |
| Auslobung Deutscher Holzbaupreis 2003 | Bautechnik | 1/2003 | 70 | Nachrichten | |
| Datenaustausch im Stahl- und Holzbau | Bautechnik | 1/2006 | 71 | Nachrichten | |
| Holzbaufachberatung geht kontinuierlich weiter | Bautechnik | 1/2003 | 71 | Nachrichten | |
| Jesse, D.; Jesse, F.; Curbach, M. | Lokale Lasteintragung über Bolzenverbindungen in dünne Bauteile aus textilbewehrtem Beton | Beton- und Stahlbetonbau | 2/2008 | 73-84 | Fachthemen |
KurzfassungDie Einleitung von Lasten über stabförmige Verbindungsmittel ist vor allem aus dem Stahlbau und Holzbau bekannt. Es ist eine einfache Möglichkeit zur Verbindung platten- und scheibenartiger Bauteile. Im Rahmen der vorliegenden Studie wird die Anwendungsmöglichkeit stabförmiger Verbindungsmittel (Bolzen) für dünne Betonbauteile mit textiler Bewehrung untersucht. Es soll geklärt werden, wie eine einfache, robuste und effiziente Lasteinleitung in dünne bewehrte Betonscheiben realisiert werden kann. Dazu wurde an insgesamt 36 Einzelversuchen das Tragverhalten der Verbindung in Abhängigkeit von den Parametern Randabstand, Bewehrungsgrad bzw. Lagenanzahl und Orientierung der Bewehrung untersucht. Aufgrund der geplanten Anwendung begrenzen sich die Untersuchungen auf eine Belastung in Scheibenebene. Anhand eines Stabwerkmodells werden die Versagensmechanismen und -formen beschrieben. x | |||||
| Bautechnik aktuell 1/2013 | Bautechnik | 1/2013 | 81-84 | Bautechnik aktuell | |
Kurzfassung
x | |||||
| Simon, Antje; Jahreis, Markus G.; Koch, Johannes; Arndt, Ralf W. | Moderne Holzbrücken planen, bauen, erhalten - Teil 1: Bauwerksentwurf | Bautechnik | 2/2020 | 85-91 | Berichte |
KurzfassungDie effiziente Planung und Errichtung dauerhafter Bauwerke wird durch die Anwendung von Regelwerken, die auf dem aktuellen Stand der Technik basieren, ermöglicht. Im Brückenbau stehen umfangreiche Richtlinien für Stahlbeton-, Spannbeton-, Stahl- und Stahl-Beton-Verbundbrücken zur Verfügung. Für Holzbrücken gilt das nicht. Für die materialgerechte Planung, den Bau, die Unterhaltung und die Prüfung von Holzbrücken fehlen Regelwerke. Um den daraus resultierenden erheblichen Wettbewerbsnachteil für den Holzbrückenbau aufzuheben, wurde an der Fachhochschule Erfurt das Forschungsvorhaben “Protected Timber Bridges (ProTimB)” initiiert. Ziel des Vorhabens war die Erarbeitung einheitlicher Richtlinien für den Entwurf, die Baudurchführung und die Erhaltung geschützter Holzbrücken in Anlehnung an die für die anderen Baustoffe anerkannten und eingeführten Regelwerke. x | |||||
| Reyer, E.; Benning, H.-H. | Zur optimalen Bemessung kippgefährdeter Brettschichtholzträger unter Gebrauchslasten und unter Brandbeanspruchung. | Bautechnik | 3/1991 | 85-92 | |
KurzfassungQuerschnittsreduzierung und Veränderung der mechanischen Eigenschaften unter Brandbeanspruchung. Erarbeitung von Bessungshilfen für kippgefährdete Brettschichtholzträger unter Gebrauchslast und im Brandfall. x | |||||
| Scheer, C.; Wagner, C. | Röntgenuntersuchungen an Nägeln, Klammern und Stabdübeln in Holz und Holzwerkstoffen. | Bautechnik | 3/1980 | 88-93 | |
KurzfassungDie Verformung und Nachgiebigkeit von Verbindungsmitteln im Holzbau. Es werden Versuche beschrieben, die mit Röntgenaufnahmen vom Bereich der zulässigen Lasten bis zum Versagen dokumentiert wurden. x | |||||