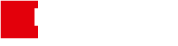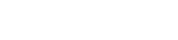Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Holzbau - Formeln und Werte auf einen Blick | Bautechnik | 1/2008 | 90-91 | Nachrichten | |
| Simon, Antje; Koch, Johannes; Jahreis, Markus G.; Arndt, Ralf W. | Moderne Holzbrücken planen, bauen, erhalten - Teil 2: Bauausführung und Erhaltung | Bautechnik | 2/2020 | 92-99 | Berichte |
KurzfassungBisher gab es für den Bau von Holzbrücken nur unzureichende Vorgaben in den nationalen und europäischen Regelwerken, woraus für den Holzbrückenbau ein erheblicher Wettbewerbsnachteil entstand. An der Fachhochschule Erfurt wurde daher das Forschungsprojekt “Protected Timber Bridges (ProTimB)” initiiert. Ziel dieses Projekts war es, einheitliche Richtlinien für den Entwurf, die Baudurchführung und die Erhaltung geschützter Holzbrücken in Anlehnung an die für die anderen Baustoffe anerkannten Regelwerke zu erarbeiten. x | |||||
| Hotter, K. | Krafteinleitung bei nachgiebigen Holzverbindungen. | Bautechnik | 3/1978 | 92-99 | |
KurzfassungBerechnung der Anschlüsse mehrteiliger Bauteile aus Holz unter Berücksichtigung der Nachgiebigkeit der Anschlussmittel insbesondere bei unterschiedlichen Verbindungsmitteln. x | |||||
| Gösele, K. | Verbesserung des Schallschutzes von Holzbauteilen durch Schwingungstilger ("akustische Blutegel") | Bauphysik | 2/2002 | 93-1001 | Fachthemen |
KurzfassungIm folgenden wird über einen neuen Effekt berichtet, mit dessen Hilfe bei leichten doppelschaligen Bauteilen, vor allem im Holzbau, durch eingebrachte Dämmschichten eine große Körperschalldämpfung der Schalen erreicht werden kann. Der Effekt beruht darauf, daß man die Dämmschicht so mit den Schalen verbindet, daß sich einzelne Resonatoren innerhalb der Dämmschicht bilden, die zu einem verstärkten Entzug von Körperschall-Energie aus den Schalen führen (Schwingungstilger). x | |||||
| Rieckmann, H-P. | Knicklängen symmetrischer und asymmetrischer verschieblicher Kehlbalkendächer. | Bautechnik | 3/1983 | 97-100 | |
KurzfassungAnhand von Versuchsauswertungen und dem analytischen Lösungsweg werden Knicklängenbeiwerte der Stabelemente von Kehlbalkendächern angegeben. x | |||||
| Mucha, A. | Zur Berechnung des Trapezsprengwerks. | Bautechnik | 3/1981 | 98-101 | |
KurzfassungDas Sprengwerk als statisches System, wie es in der Verhangenheit oft vor allem bei Holzbrücken zum Einsatz kam. x | |||||
| Schöne, W. | Beurteilung von phenolharzverleimtem Brettschichtholz nach langjähriger Nutzungsdauer. | Bautechnik | 2/1994 | 104-113 | Fachthemen |
KurzfassungBrettschichtholz wurde auf dem Gebiet der ehemaligen DDR etwa seit 1960 hergestellt. Ausgangs des Jahres 1989 betrug der Bestand an verbautem Brettschichtholz etwa 300 000 m3. Für die Verleimung stand ausschließlich säurehärtendes Phenolformaldehydharz zur Verfügung. Die Säurehärtung führte zu dem Verdacht der Holzschädigung. Eine Untersuchung von Bohrkernen aus ausgewählten, inzwischen bis zu 30 Jahre alten Bauwerken soll Aufschluß über den gegenwärtigen Zustand der Phenolharz-Verleimungen geben. Hierzu werden die Scherfestigkeit und die Querzugfestigkeit der Leimfugen geprüft. Der Vergleich mit früheren, an neuem Holz und frischen Verleimungen gewonnenen Versuchsergebnissen zeigt, daß ein signifikanter Festigkeitsabfall nicht eingetreten ist. x | |||||
| Schanack, Frank; Ramos, Óscar Ramón; Osman, Juan Pablo; Oyarzún, Pablo | A contribution to understanding the influence of concrete cracking on timber concrete composite bridge beams | Bautechnik | 2/2015 | 105-110 | Aufsätze |
KurzfassungDespite of widely implemented advances in TCC bridge technology, there are still no satisfying design recommendations that consider the influence of concrete cracking on the distribution of forces and deformation. A research project at Universidad Austral de Chile studied several aspects of concrete cracking in TCC bridges with timber beams of greater depth than width using elastic dowel-type shear connectors. One of the results of concrete cracking is a reduction of the slip modulus of the connectors. This weakening was simulated in shear tests by a small gap between the timber and the concrete. A test calibrated FEM model was used for a parametric study of 120 different cases, most of which did not show concrete cracking. Where concrete cracking occurred, it caused an increase in the timber tensile stresses and beam deflection of up to 20 %. We conclude that concrete cracking occurs when the timber-concrete depth ratio is less than four times the cubic root of the effective flange width of the concrete slab. x | |||||
| Holzbau Kalender 2002 (Ehlbeck, J.) | Bauphysik | 2/2003 | 107 | Bücher | |
| Bautechnik aktuell 2/2023 | Bautechnik | 2/2023 | 109-115 | Bautechnik aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x | |||||
| Werner, G. | Unterhaltungskosten von Holzbrücken. | Bautechnik | 4/1988 | 109-113 | |
KurzfassungZur Ermittlung realitätsbezogener Unterhaltungskosten von Holzbrücken wurden die für 27 Brücken verfügbaren Daten aufbereitet und kritisch ausgewertet. x | |||||
| Topole, K.; Topole, J. | Berechnung zusammengesetzter Holz-Stahlträger. | Bautechnik | 2/1997 | 111-116 | Fachthemen |
KurzfassungEs wird eine Methode vorgestellt, mit der zusammengesetzte Holz-Stahlträger berechnet und bemessen werden können. Die Methode bietet die Möglichkeit, alle Parameter des Systems genau festzulegen, das System unter den genauen Randbedingungen bezüglich der Lastenleitung und der Auflagerbedingungen zu beschreiben und liefert dem Konstrukteur die Schnittgrößen und Verformungen für die Bemessung des Holzbalkens, des Stahlträgers und aller Verbindungselemente. Die Verbindungselemente zwischen Holz- und Stahlträger werden bei der vorgestellten Methode mit ihrem Verschiebemodul einbezogen und lassen sich in ihrer Abmessung und Anordnung gemäß den statischen Erfordernissen sowie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten festlegen. Die Methode zeichnet sich sowohl durch ihre hohe Genauigkeit als auch durch ihre große Flexibilität und Einfachheit aus. Es besteht die Möglichkeit, alle einzelnen Parameter des Systems genau festzulegen und zu verändern, wie es bei bisher bekannten Methoden nicht möglich ist. x | |||||
| Rug, W. | 10. Holzbauseminar. | Bautechnik | 2/1994 | 117-119 | Berichte |
| Werner, G. | Konstruktionselemente des Metallbaus im Ingenieurholzbau. | Bautechnik | 4/1989 | 120-126 | |
KurzfassungIn zwei Forschungsprojekten wurden Konstruktionselemente aus dem Metallbau für den Einsatz im Holzbau untersucht. Zur Beurteilung der Eignung von Metall-Holz-Klebeverbindungen wurde ein Programm mit über 200 Einzelversuchen unter Berücksichtigung verschiedener Parameter durchgeführt. Um die Geometrie von Metalleinschraubhülsen unter Berücksichtigung der Handhabung und der Lastübertragungsmechanismen für das örtliche Einleiten von Kräften in den Verankerungsgrund Holz zu optimieren, wurde ein Programm mit nahezu 450 Einzelversuchen ausgewertet. x | |||||
| Schneider, U.; Oswald, M. | Brandrisiko in Wohngebäuden unterschiedlicher Art, Teil 1 | Bauphysik | 3/2003 | 122-130 | Fachthemen |
KurzfassungDie aktuelle Musterbauordnung vom Oktober 2002 sieht die Gleichstellung tragender Baukonstruktionen in der neuen Gebäudeklasse 4 vor, d. h. bis zu einer Gebäudehöhe von 13 m dürfen diese Konstruktionen in Massivbauweise oder Holzbauweise errichtet werden. Aufgrund des damit verbundenen erhöhten Brandrisikos im Geschoßwohnbau wurde die Erarbeitung einer Muster-Holzbaurichtlinie mit neuen Konstruktionsvorschriften für den mehrgeschossigen Holzwohnbau notwendig. Damit sollen die bestehenden Schwachstellen im Geschoßwohnbau beseitigt werden. Daß diese Vorgehensweise dringend erforderlich ist, haben die vorliegenden Untersuchungen an bestehenden Gebäuden bestätigt. Die vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, daß das Risikopotential durch das Ereignis "Brand" im Wohnbau in starker Abhängigkeit von der Art der Bauweise steht. Die Möglichkeit der gestalterischen Freiheit, die Planern und Bauherren mit den neueren Entwicklungen in den Rechtsgrundlagen geboten werden, erfordern verantwortungsbewußte Planung, um nicht ein Absinken des Sicherheitsniveaus zu riskieren. Die Verwendung von brennbaren Stoffen in mehrgeschossigen tragenden Gebäudekonstruktionen erfordert die Betrachtung der Tragfähigkeit des Gesamtsystems und nicht der Brandwiderstandsdauer einzelner Bauteile. Dies betrifft vor allem den Mehrgeschoßbau, da das Versagen einzelner Bauelemente und deren Verbindungen katastrophale Folgen für das gesamte Gebäude haben kann. Die gültigen Normen DIN 4102 und ÖNORM B 3800 sowie die betreffenden Eurocodes berücksichtigen bereits weitgehend, daß Bauteile nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Dazu sind grundlegende Kenntnisse über den Brandschutz erforderlich, insbesondere sind die konstruktiven Schwachpunkte wie Anschlüsse und Verbindungen zu beachten und zu bewerten. x | |||||
| Holzbauforum 2020. Holzbau - bereit für den Massenmarkt? | Bautechnik | 2/2020 | 125 | Veranstaltungen | |
| Famers, G. | Die Brandschutzvorschriften der neuen Musterbauordnung | Bauphysik | 3/2003 | 131-136 | Fachthemen |
KurzfassungDie ARGEBAU (Konferenz der für das Bauwesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder) hat im November 2002 eine neue Musterbauordnung verabschiedet. Neben der Änderung der Verfahrensvorschriften wurden auch die Brandschutzvorschriften der Musterbauordnung überprüft. Ziele waren dabei die Angleichung der Ländervorschriften, die Berücksichtigung der harmonisierten europäischen Brandschutznormen und der Abbau ungerechtfertigter Hindernisse für den Holzbau auf der Basis von Forschungsvorhaben über die Holzbauweise. x | |||||
| Bauphysik Aktuell 2/2021 | Bauphysik | 2/2021 | 133-137 | Bauphysik Aktuell | |
KurzfassungAktuell: x | |||||
| Eßmann, F. | Holzbau und Holzschutz von A bis Z (Hähnel, E.) | Bauphysik | 2/2008 | 133 | Bücher |
| Güldenpfennig, J.; Vogelsberg, A.; Stamminger, P. | Zur Feuchteproblematik in Eissporthallen | Bautechnik | 3/2010 | 133-138 | Fachthemen |
KurzfassungAufgrund vieler Untersuchungen zur Standsicherheit von Eissporthallen wurde festgestellt, dass diese in unterschiedlichem Maße saniert werden müssen. Die Holzfeuchtigkeit der Tragkonstruktionen betrug meistens langanhaltend über 20 %. Daher wurden Untersuchungen zu den Ursachen hoher Holzfeuchten in Eissporthallen durchgeführt. Eine der Ursachen liegt in dem Strahlungsaustausch zwischen der Hallendecke und der Eisfläche. Zu dieser Problematik wurden Versuche durchgeführt und daraus mögliche Verbesserungsvorschläge für Eissporthallen abgeleitet. x | |||||
| Deutscher Holzbautag 2003 | Bautechnik | 2/2003 | 134 | Termine | |
| Fülle, Claudia; Leopold, Nadine | WDVS im Holzbau - Optimierter Nachweis des dauerhaften Witterungsschutzes durch Kombination von Messungen im Wandprüfstand und hygrothermischen Simulationen | Bauphysik | 3/2016 | 135-146 | Fachthemen |
KurzfassungWärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) für die Anwendung auf Außenwänden im Holzbau werden national durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen geregelt. Im Zuge der Zulassungserteilung muss der dauerhaft wirksame Witterungsschutz der Holzkonstruktion durch das WDVS nachgewiesen werden. Dies kann im Wandprüfstand durch die Messung von Holzfeuchten sowie Temperaturen und rel. Luftfeuchten in verschiedenen Bereichen der Konstruktion bei hygrothermischer Belastung nach ETAG 004 erfolgen. Hersteller von WDVS sind bestrebt, den Zeit- und Kostenaufwand für solche Prüfungen zu optimieren, indem aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Putze und Dämmstoffe nur die ungünstigsten Kombinationen geprüft werden. Die Entscheidung über die ungünstigste Variante wird meistens anhand einzelner Kriterien, wie Wasserdampfdurchlässigkeit des Putzes, getroffen. Die hygrothermischen Simulationen haben jedoch gezeigt, dass bei Einbeziehung verschiedener Randbedingungen die ungünstigste Variante nicht immer erwartungsgemäß ausfällt. Der Beitrag zeigt beispielhaft, wie und unter welchen Voraussetzungen Simulationsberechnungen zu einer sicheren Einschätzung des hygrothermischen Verhaltens der verschiedenen Varianten einer Wandkonstruktion führen. x | |||||
| Fülle, Claudia; Leopold, Nadine | WDVS im Holzbau - Optimierter Nachweis des dauerhaften Witterungsschutzes durch Kombination von Messungen im Wandprüfstand und hygrothermischen Simulationen | Bauphysik | 3/2016 | 135-146 | Fachthemen |
KurzfassungWärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) für die Anwendung auf Außenwänden im Holzbau werden national durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen geregelt. Im Zuge der Zulassungserteilung muss der dauerhaft wirksame Witterungsschutz der Holzkonstruktion durch das WDVS nachgewiesen werden. Dies kann im Wandprüfstand durch die Messung von Holzfeuchten sowie Temperaturen und rel. Luftfeuchten in verschiedenen Bereichen der Konstruktion bei hygrothermischer Belastung nach ETAG 004 erfolgen. Hersteller von WDVS sind bestrebt, den Zeit- und Kostenaufwand für solche Prüfungen zu optimieren, indem aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Putze und Dämmstoffe nur die ungünstigsten Kombinationen geprüft werden. Die Entscheidung über die ungünstigste Variante wird meistens anhand einzelner Kriterien, wie Wasserdampfdurchlässigkeit des Putzes, getroffen. Die hygrothermischen Simulationen haben jedoch gezeigt, dass bei Einbeziehung verschiedener Randbedingungen die ungünstigste Variante nicht immer erwartungsgemäß ausfällt. Der Beitrag zeigt beispielhaft, wie und unter welchen Voraussetzungen Simulationsberechnungen zu einer sicheren Einschätzung des hygrothermischen Verhaltens der verschiedenen Varianten einer Wandkonstruktion führen. x | |||||
| Heimeshoff, B. | Praktische Spannungsberechnung für den gekrümmten Träger mit Rechteckquerschnitt. | Bautechnik | 4/1967 | 135-140 | |
KurzfassungEs wird ein Rechenverfahren basierend auf der technischen Biegelehre gezeigt, das zwar nicht "exakt" ist, aber eine gute Annäherung an die tatsächliche Beanspruchung erlaubt. Anwendung z.B. für gekrümmte Leimbinder im Holzbau. x | |||||
| Gerold, M. | Vergleich der alternativen Spannungsnachweise bei Dachtragwerken aus Stahl und Holz. | Bautechnik | 4/1989 | 137-140 | |
KurzfassungDachtragwerke werden im wesentlichen aus ständiger Last sowie Schnee- und Windlast beansprucht. Für den Nachweis der Standsicherheit sind in den gültigen Bemessungs- und Ausführungsnormen für Stahlbauten (DIN 18800) und Holzbauten (DIN 1052) einerseits und der Norm für Lastannahmen (DIN 1055, Teil 4 und 5) andererseits konkurriernde Kombinationsregeln für Lasten angegeben. Es wird eine Entscheidungshilfe insbesondere bei statischen Grenzfällen und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Hinblick auf die Bemessung nach den einzelnen Regelwerken durchgeführt. x | |||||