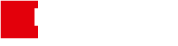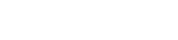Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatsmedaille für Josef Vögele | Bauphysik | 5/1998 | 171 | Persönliches | |
| Bundesverband Porenbeton: Neuer Vorstand | Bauphysik | 5/1998 | 171 | Persönliches | |
| Sedlbauer, K.; Würth, M. | Instationär thermo-hygrische Untersuchung eines belüfteten Flachdaches | Bauphysik | 4/1998 | 105-109 | Fachthemen |
KurzfassungMit Hilfe eines dreidimensionalen Finite-Differenzen-Programms (INSTW) zur Ermittlung von Wärmeströmen und eines eindimensionalen instationären Berechnungsverfahrens für den gekoppelten Wärme- und Feuchtetransport (WUFI) wird in mehrdimensionalen, instationären Berechnungen der Wärme- und Feuchtetransport im Bereich des Belüftungskanals am Beispiel eines Zweischalenflachdaches untersucht. Für ausgewählte klimatische Randbedingungen werden eine normierte Häufigkeit des Tauwasseranfalls sowie räumlich-zeitliche Insographendarstellungen der relevanten Feuchte für die wichtigsten Einflußgrößen ermittelt. Ergänzend dazu werden Wassergehalte der Massivbauteile sowie im Bereich der Luftschicht und des Dämmstoffes ermittelt, um das Austrocknen einer baufeuchten Konstruktion darzustellen. x | |||||
| Ludwig, D. | Neue Verschattungsmöglichkeiten im Geschoßbau | Bauphysik | 4/1998 | 110-114 | Fachthemen |
KurzfassungAuf Fassaden mit transparenter Wärmedämmung (TWD-Fassaden) abgestimmt, bietet der Einsatz der neuartigen Liquidverschattung die Möglichkeit, ein 100 %iges Verschattungspotential, aber auch uneingeschränkte Transmission bei Bedarf zu erzielen. Da die Transmissionsverringerung durch ein strahlungsabsorbierendes Liquid erreicht wird, welches unempfindlich auf thermische Beanspruchung reagiert, entsteht somit ein Verschattungssystem, das wesentliche Vorteile in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Flexibilität besitzt. Das Liquid besteht aus einer Farbstofflösung mit lichtechten Farbstoffen. Der einfache Aufbau als Zweischeiben-Verglasung, die mit der Verschattungsflüssigkeit gefüllt werden kann, ermöglicht den Einbau in herkömmliche Pfosten-und-Riegel-Konstruktionen. Das Absorptionsverhalten des Liquides ist auch bei geringen Schichtdicken (5 mm) gut und kann den jeweiligen Erfordernissen durch Konzentrationserhöhungen angepaßt werden. x | |||||
| Ressourcenschonendes Bauen | Bauphysik | 4/1998 | 114 | Aktuelles | |
| Eisenmann, G. | Ist das Heizsystem im künftigen Niedrigenergiehaus problematisch? | Bauphysik | 4/1998 | 115-121 | Fachthemen |
KurzfassungUm eine Antwort auf diese Frage, ob das Heizsystem im künftigen Niedrigenergiehaus problematisch ist, beantworten zu können, bedarf es einer Ausgangsbasis, im Vergleich zu der ein Heizsystem beurteilt werden kann. Aufgrund von in-situ-Versuchen ist eine grobe Beurteilung möglich. Für einen korrekten Vergleich wird ein ideales Heizsystem definiert. Daraus lassen sich die bei einem realen Heizsystem anzustrebende Zeile ableiten. Der energetische Mehraufwand eines realen Heizsystems im Vergleich zu einem idealen Heizsystem läßt sich anschaulich über die sogenannte Systemaufwandszahl beurteilen, die nur durch Simulationsrechnungen ermittelt werden kann. Mit Hilfe von Simulationsrechnungen lassen sich außerdem Schwachstellen der Heizsysteme erkennen und Einsparpotentiale ermitteln. x | |||||
| Erker, A. | Anisotropie der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelscherben im Zusammenhang "Messen- Rechnen" von Ziegelmauerwerk | Bauphysik | 4/1998 | 122-125 | Fachthemen |
KurzfassungDie numerische Berechnung der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit von Hochlochziegeln bzw. von Ziegelmauerwerk ist nur dann sinnvoll, wenn der Materialparameter "Scherbenleitfähigkeit" als Ausgangsgröße hinreichend genau bekannt ist. Die Wärmeleitfähigkeit von Ziegelscherben wurde in zwei zueinander senkrecht liegenden Meßrichtungen bestimmt. Die sich ergebenden abweichenden Scherbenwärmeleitfähigkeiten wurden unter Berücksichtigung der Ziegelquerschnitte jeweils einer numerischen Berechnung zugrunde gelegt und die äquivalente Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerks bzw. Ziegeln errechnet. Zum Vergleich dazu wurde der Wärmedurchlaßwiderstand der jeweiligen Ziegel aufgrund einer Messung (Wandprüfstand nach DIN 52611 und Einzelsteinmeßgerät) bestimmt. x | |||||
| Projekte des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik erhalten Auszeichnungen | Bauphysik | 4/1998 | 126 | Aktuelles | |
| FIW in neuen Räumen | Bauphysik | 4/1998 | 126-127 | Aktuelles | |
| Photovoltaik: Sonnenstrom kommt mühsam voran - Neuer Anlauf zur Massenproduktion in Japan und Deutschland | Bauphysik | 4/1998 | 127 | Aktuelles | |
| Dissertationen Schallsteuerung und Schallabsorption von Oberflächen aus mikroperforierten Streifen (J. Hunecke) | Bauphysik | 4/1998 | 129 | Dissertationen | |
| Leserforum Zuschrift zu: G. Hauser, F. Otto: Auswirkungen eines erhöhten Wärmeschutzes auf die Behaglichkeit im Sommer (H. Erhorn); Erwiderung (G. Hauser, F. Otto) | Bauphysik | 4/1998 | 130 | Leserforum | |
| Dr.-Ing. Kurt Kießl zum Honorarprofessor ernannt | Bauphysik | 4/1998 | 130 | Persönliches | |
| Erhorn, H. | Nullheizenergiehäuser marktreif - auch marktfähig? | Bauphysik | 3/1998 | 69-73 | Fachthemen |
KurzfassungEs wird gezeigt, daß Nullheizenergiehäuser nicht zu "Null"-Heizkosten und auch nicht zur gänzlichen Eliminierung des heizungsbedingten Kohlendioxidausstoßes führen, weil der Stromverbrauch ansteigt, je mehr man sich dem Nullheizenergiehaus nähert. Die Entwicklung des Nullheizenergiehauses ermöglicht die Erschließung eines erheblichen Energieeinsparpotentials. Allerdings ist dies auch mit nicht unerheblichen Mehrkosten verbunden. Der Mehrkosten-Wert für ein Nullheizenergiehaus in Höhe von 800,- DM/m² muß künftig noch deutlich reduziert werden. Er läßt sich mit Sicherheit auf unter 500,- DM/m² senken, wenn eine bessere Integration in den architektonischen Entwurf erfolgt und die Anlagensysteme, die bislang Unikate waren, in Serie gehen. Auch bei den Solarkollektoren müßten noch erhebliche Preissenkungen möglich sein. x | |||||
| Primärenergie-Paß für Gebäude | Bauphysik | 3/1998 | 73 | Aktuelles | |
| Biomasseheizwerk eingeweiht | Bauphysik | 3/1998 | 73 | Aktuelles | |
| Hauser, G.; Heibel, B. | Bemessungsgrundlagen für Zuluftfassaden | Bauphysik | 3/1998 | 74-80 | Fachthemen |
KurzfassungEs werden energetische Betrachtungen von Zuluftfassaden hinsichtlich Standort, Orientierung, Aufbau und Geometrie vorgestellt. Die Untersuchungen zeigen, daß Lüftungswärmeverluste durch Zuluftfassaden um bis zu etwa 50 % verringert werden können. Eine wirkungsvolle Zuluftfassade besitzt eine transluzente Vorsatzschale, eine Kanaltiefe von 2 bis 24 mm und ist auf einer südorientierten, wärmegedämmten Wand angebracht. Ein besonderes Augenmerk wird bei der Orientierung des Aufbaus auf den Strömungswiderstand und die erforderliche Kanaltiefe der Systeme gerichtet. Zur Bemessung kann die energetische Wirkung von Zuluftfassaden innerhalb eines weiten Parameterbereichs abgeschätzt werden. x | |||||
| Geothermie - ein neues Betätigungsfeld für den Brunnenbau | Bauphysik | 3/1998 | 80 | Aktuelles | |
| Blum, H.-J. | Das innovative Raumklimakonzept - Eine ganzheitliche, wirtschaftlich- ökologische Lösung für ein Bürohochhaus in der Innenstadt | Bauphysik | 3/1998 | 81-86 | Fachthemen |
KurzfassungAm Beispiel des hier vorgestellten Konzeptes soll aufgezeigt werden, daß die natürliche Lüftung in Kombination mit einer hinterlüfteten doppelschaligen Fassade sowie mit einer im Raum angeordneten statischen Heizung und Kühlung eine zukunftsorientierte Alternative zu den herkömmlichen Klimaanlagen ist. Eine Alternative, die keinen Komfortverzicht hinsichtlich des Raumklimas, sondern lediglich eine geringfügige Komforteinschränkung nach sich zieht. Diese Einschränkung, gemessen an dem großen Energiesparpotential und der Verlängerung der Lebensdauer der Gebäudetechnik, hält der Verfasser als durchaus akzeptabel, um sich für die Realisierung dieses Raumklimakonzeptes einzusetzen. x | |||||
| Zhou, X.; Heinz, R.; Fuchs, H. V. | Zur Berechnung geschichteter Platten- und Lochplatten-Resonatoren | Bauphysik | 3/1998 | 87-95 | Fachthemen |
KurzfassungEs wird die Qualität vereinfachter Rechenverfahren zur Ermittlung des Absorptionsgrads bei senkrechtem Schalleinfall auf ein- und mehrschichtige Platten- bzw. Lochplatten-Resonatoren überprüft. Hierzu werden für verschiedene Absorber-Anordnungen Vergleiche zwischen dem berechneten und dem im Kundtschen Rohr gemessenen Absorptionsgrad durchgeführt. Die Übereinstimmung ist gut. Damit können auch neuartige Absorber optimiert werden, die bei der Entwicklung breitbandig wirksamer und vielseitig einsetzbarer faserfreier Bauteile für die Raumakustik und Lärmbekämpfung an Bedeutung gewonnen haben. x | |||||
| Neue Formen der Markteinführung von Solarstrom | Bauphysik | 3/1998 | 95 | Aktuelles | |
| Bremer Neubausiedlung mit dachintegrierten Solaranlagen | Bauphysik | 3/1998 | 95-96 | Aktuelles | |
| Regenerative Energien: Neue Vergütung für Stromeinspeisung | Bauphysik | 3/1998 | 96 | Aktuelles | |
| Off-Shore-Windparkanlagen für Dänemark | Bauphysik | 3/1998 | 96 | Aktuelles | |
| Arbeitskreis Melaminharz-Schaumstoff in FSK | Bauphysik | 3/1998 | 97 | Aktuelles | |