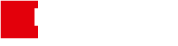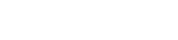Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Geißler, Karsten | Zur Frage der Nachhaltigkeit im Brückenbau | Stahlbau | 2/2022 | 71 | Editorials |
| Gerritzen, D.; Falkner, H. | Zur Frage der Nachnutzbarkeit verbundlos vorgespannter Stahlbetondecken nach Brandeinwirkung | Beton- und Stahlbetonbau | 11/2006 | 863-871 | Fachthemen |
KurzfassungIn dem vorliegenden Beitrag wird der Einfluß verschiedener Brandeinwirkungen im Hinblick auf die Weiter- bzw. Nachnutzungsmöglichkeiten verbundlos vorgespannter als auch normal bewehrter Stahlbetondecken nach einem Brand aufgezeigt. Es werden die wichtigsten Zusammenhänge zwischen Brandeinwirkung, Verhalten des Bauteils während des Brandes und der anschließenden Weiternutzungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es wird eine Konstruktionsweise im Sinne einer guten Nachnutzbarkeit nach Brand aufgezeigt. Ratschläge und Tipps für die Praxis können entnommen werden. x | |||||
| Specht, M. | Zur Frage der notwendigen Mindestbetondeckung von Außenbauteilen und ihrer Wechselbeziehung zur Nachbehandlung des Betons. | Bautechnik | 5/1983 | 175-179 | |
KurzfassungEs werden näherungsweise Zusammenhänge entwickelt zwischen der Betondeckung, dem Wasser-Zement-Wert, der Kapillarporosität, dem Hydratationsgrat, der Nachbehandlung und der Wassereindringtiefe des Betons. Hieraus wird eine empfohlene Mindestbetondeckung abgeleitet. x | |||||
| Indlekofer, H. | Zur Frage der Profilform kelchförmiger Überfallbauwerke. | Bautechnik | 6/1977 | 203-207 | |
KurzfassungEs wird eine kritische Bestandsaufnahme der gängigen Profilformen von kelchförmigen Überfallbauwerken vorgenommen. Danach sollten die Profilformen nach Wagner gewählt werden. Es werden Formeln angegeben, mit deren Hilfe die explizite Bestimmung der Profilkenndaten möglich ist. x | |||||
| Kovacs, I. | Zur Frage der Seilschwingungen und der Seildämpfung. | Bautechnik | 10/1982 | 325-332 | |
KurzfassungDie Ursache von Seilschwingungen mit z.T. sehr grossen Amplituden bei abgespannten Bauwerken können i.w. auf Überlagerungen von Eigenschwingungen des Bauwerks und der Seile zurückgeführt werden. Erzeugt werden sie durch Verformungen der Seilendpunkte. x | |||||
| Struck, W. | Zur Frage der Sicherheit bei der Beurteilung von Bauteilen nach Versuchsergebnissen. | Bautechnik | 6/1971 | 188-195 | |
KurzfassungDer Begriff und die Größe der Sicherheit sowie die Größe der Sicherheit der Aussage werden in der Sprache der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen Statistik dargestellt. x | |||||
| Fastabend, M. | Zur Frage der Spanngliedführung bei Vorspannung ohne Verbund | Beton- und Stahlbetonbau | 1/1999 | 14-19 | Fachthemen |
KurzfassungDie bisherige Spanngliedführung bei Vorspannung ohne Verbund in Deutschland wird im wesentlichen durch die DIN 4227, Teil 6 geprägt. Abweichend von diesen Normvorgaben wird in dem Beitrag die statische Wirkung einer Stützstreifenvorspannung mit trapezförmigem Kabelverlauf im Aufriß vorgestellt. Die daraus resultierenden günstig wirkenden Biegemomente und Verformungen werden im Vergleich mit einer verteilten Spannbewehrung diskutiert und bewertet. x | |||||
| Rosemeier, G.-E. | Zur Frage der universellen Naturkonstanten | Bautechnik | 1/2000 | 55-58 | Fachthemen |
KurzfassungNach dem heutigen Stand der Erkenntnis sind sechs Konstanten zum Aufbau der gesamten Welt erforderlich. Hieraus lassen sich dimensionslose Kennwerte durch Kombination der Konstanten definieren, die eine interessante Überprüfung (Eichung) der vorgelegten physikalischen Theorien gestatten. Eine sauber definierte ("richtige") neue Physik dürfte auch für die technische Anwendung von großer Bedeutung sein und entscheidende Neuerkenntnisse liefern. x | |||||
| Weinhold, J. | Zur Frage der Untergrundsanierungen im Bauwesen mit der Wünschelrute. | Bautechnik | 12/1984 | 432-435 | |
KurzfassungEs wird das Stabilitätsproblem der Wünschelrute behandelt. Dabei bleibt die Ursache der biologisch-neurologischen Wirkung auf das Muskelspiel der die Rute haltenden Finger infolge exogener Unstetigkeitsstellen offen. x | |||||
| Weinhold, J. | Zur Frage der Untergrundsondierungen im Bauwesen mit der Wünschelrute. | Bautechnik | 2/1991 | 65-66 | |
| Franke, H. | Zur Frage der Wärmedämmschichtdicke auf Stahlbetondächern (Warmdächern) mit grossen Fugenabständen. | Bautechnik | 11/1968 | 380-385 | |
KurzfassungEs wird die Temperatur in Betondächern im jahreszeitlichen Verlauf in Abhängigkeit von der Dämmschichtdicke analytisch untersucht und der Frage nachgegangen ob der Dehnfugenabstand zur Verhinderung von Zwängungen durch dickere Dämmschichten vergrössert werden kann. x | |||||
| Künzel, H. | Zur Frage der Überbrückung von Bewegungsfugen durch Wärmeverbundsysteme | Bauphysik | 5/1998 | 140-144 | Fachthemen |
KurzfassungZur Frage der Überbrückung von Bewegungsfugen durch Wärmedämmverbundsysteme gibt es unterschiedliche Meinungen: Die Anwender weisen auf gute Erfahrungen in der Praxis hin, rechnerische Untersuchungen lassen hingegen eine spezielle Überprüfung für zweckmäßig erscheinen, die bisher bei der Zulassung solcher Systeme gefordert worden ist. Untersuchungen an einem Fachwerk-Versuchshaus mit nachträglich aufgebrachtem Wärmedämmverbundsystem bestätigen dessen fugenüberbrückende Eigenschaft beim Schwinden des Fachwerkholzes. Demnach ist bei Dämmschichtdicken von mindestens 80 mm ein Nachweis der Fugenüberbrückungs-Fähigkeit generell nicht erforderlich. x | |||||
| Huber, A. | Zur Frage der Zwangschnittkräfte aus Vorspannung und deren Einfluß auf die Sicherheit der Tragwerke. | Beton- und Stahlbetonbau | 3/1983 | 69-73 | |
KurzfassungEs wird der Einfluss von Zwangsmomenten auf Spannbetonträger im elastischen Bereich und im Bruchzustand durch Modellrechnungen und die Auswertung früherer Versuche gezeigt. Es wird die Annahme bestätigt, daß die Bruchlast durch Zwangmomente nicht vermindert wird. x | |||||
| Roik, K.; Hanswille, G.; Kina, J. | Zur Frage des Biegedrillknickens bei Stahlverbundträgern. | Stahlbau | 11/1990 | 327-333 | Fachthemen |
KurzfassungAuf der Grundlage der DIN 18 800 Teil 2 und des EUROCODE 3 wird ein Biegedrillknicknachweis hergeleitet und anhand von Versuchsergebnissen überprüft. Parameterstudien zeigen, daß für übliche Verbundträger des Hochbaus, bei denen Walzprofile verwendet werden, in vielen Fällen auf einen Biegedrillknicknachweis verzichtet werden kann. Für Verbundträger mit Walzprofilen aus St 37 bzw. St 52 werden Grenzprofilhöhen angegeben, bis zu denen ein Biegedrillknicknachweis nicht erforderlich ist. x | |||||
| Profanter, H. | Zur Frage des Kontaktdruckes bei gekoppelten Systemen unter Normalkrafts- und Querbelastung. | Bautechnik | 10/1976 | 345-346 | |
KurzfassungÜber das Abhebeproblem von gekoppelten Systemen (z.B. im Verbundbau) bei Quer- und Normalbelastung, z.B. bei Verbundträgern im Bereich von Stützmomenten ohne Verdübelung der Platte mit dem Träger x | |||||
| Hartl, G. | Zur Frage des Korrosionsschutzes und von Instandsetzungsgrundsätzen im Stahlbetonbau. | Beton- und Stahlbetonbau | 10/1988 | 265-270, 308-309 | |
KurzfassungDie chemischen Vorgänge bei der Korrosion von Bewehrungsstahl und ihre Ursachen werden erläutert. Mögliche Vorgangsweisen, den Korrosionsschutz wieder herzustellen, bestehen zum einen darin, durch eine ausreichend dichte und dicke Betondeckung das alkalische Milieu der Betonporenlösung und damit die Repassivierung des Stahls zu bewirken. Zum anderen kann auch in den Korrosionsmechanismus eingegriffen werden, z.B. durch Absenken der Betonfeuchtigkeit oder Beschichten der Stahloberfläche, sowie in der Kombinatiom beider Verfahren. Ausführungsbeispiele hierzu werden gezeigt. x | |||||
| Eibl, J.; Landahl, H.; Häußler, U.; Gladen, W. | Zur Frage des Silodrucks. | Beton- und Stahlbetonbau | 4/1982 | 104-110 | |
KurzfassungEine Reihe von Schadensfällen an Silokonstruktionen, die vor allem bei kohäsiven Schüttgütern (wie z.B. Sojaschrot) sowie bei ausmittig angeordneten Abzugsvorrichtungen und Einbauten vorgefallen sind, war Anlaß der Untersuchung. Insbesondere die Beanspruchung der Silowand beim Füll- und Entleerungsvorgang und der inneren Reibung des Schüttguts sind von großer Bedeutung. Es werden Spannungszustände mit Hilfe der Kontinuumsmechanik beschrieben und eigene Messungen der Silodrücke von den Autoren erläutert. x | |||||
| Pöttler, R.; Spanke, H.; Bieger, K. W. | Zur Frage einiger Näherungen bei der Berechnung der Momentenumlagerung in Stahlbetontragwerken. | Beton- und Stahlbetonbau | 4/1991 | 83-85 | |
KurzfassungEs wird ein Näherungsverfahren beschrieben, das es erlaubt, Schnittmomente in Durchlaufträgern zu bestimmen unter Ansatz des nicht-linearen Werkstoffverhaltens des Stahlbetons. Insbesondere wird die Mitwirkung des Betons auf Zug zwischen den Rissen berücksichtigt. x | |||||
| Kurrer, K.-E. | Zur Frühgeschichte des Stahlbetonbaus in Deutschland - 100 Jahre Monier-Broschüre. | Beton- und Stahlbetonbau | 1/1988 | 6-12 | |
KurzfassungAm Beispiel der im Jahre 1888 von G. A.. Wayss und M. Koenen veröffentlichten Monier-Broschüre wird das für die spätere Entwicklung des Stahlbetonbaus charakteristische Zusammenwirken zwischen technischem Versuch und technikwissenschaftlicher Theorienbildung einerseits sowie Baupraxis andererseits aufgezeigt. Vergleichsrechnungen mit verschiedenen historischen Berechnungstheorien an Plattenstreifen aus der Monier-Broschüre zeigen die Leistungsfähigkeit des ersten, von Koenen geschaffenen Bemessungsverfahrens. x | |||||
| Brune, B. | Zur Gebrauchstauglichkeit dreiseitig und vierseitig gelagerter Platten unter Druck- und Biegebeanspruchung | Stahlbau | 3/1999 | 212-227 | Fachthemen |
KurzfassungNach den gültigen Vorschriften DIN 18800, Teil 2 und Teil 3, sowie Eurocode 3 und dem neuen Ansatz von Brune werden zur Ermittlung der Beultragfähigkeit von drei- und vierseitig gelagerten Stahlblechen unter Druck- und Biegebeanspruchung überkritische Beultragfähigkeiten zugelassen. Dadurch können sich jedoch lokal so große Verformungen dieser Platten einstellen, daß die Gebrauchstauglichkeit deutlich eingeschränkt ist. Im folgenden Bericht werden theoretische Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit von druck- und biegebeanspruchten, drei- und vierseitig gelagerten Stahlblechen vorgestellt. Es werden einfache Ansätze zur Abschätzung von maximalen Ausbiegungen von drei- und vierseitig gelagerten Platten unter Druck- und Biegebeanspruchung entwickelt und deren Güte durch einen Vergleich mit Experimenten belegt. x | |||||
| Barthel, R.; Jagfeld, M. | Zur Gelenkbildung in historischen Tragsystemen aus Mauerwerk | Bautechnik | 2/2004 | 96-102 | Fachthemen |
KurzfassungDurch Experimente, numerische Berechnungen und analytischen Untersuchungen kann gezeigt werden, daß in gemauerten Bauteilen aufgezwungenen Rotationen zu wenigen, verhältnismäßig breiten Rissen führen. Je kleiner die inneren Druckkräfte in einem Bauteil sind, desto eher konzentrieren sich die Verdrehungen. In Gewölben, die oft nur Ihr Eigengewicht abtragen, sind daher öfters einzelne breite Risse zu beobachten als in gemauerten Pfeilern, die in der Regel wesentlich stärker beansprucht werden. Im Umkehrschluß lassen breite, einzelne Risse im Mauerwerk in erster Linie auf Bewegungen schließen und nicht auf Überlastungen. x | |||||
| Henning, G. | Zur genauen Berechnung konstruktiv orthotroper Platten. | Stahlbau | 3/1972 | 78-86 | Fachthemen |
| Zangl, L. W. | Zur Genauigkeit der Standsicherheitsberechnungen von Böschungen. | Bautechnik | 9/1978 | 311-318 | |
KurzfassungKritische Beleuchtung gängiger Verfahren (Bishop, Krey, Taylor, Janbu u.a.) zur Berechnung der Böschungssicherheit. Diese Methoden ergeben meist einen Sicherheitsbeiwert an der unteren Schranke, der tatsächliche ist meist geringer. Der Verfasser schlägt ein verbessertes Verfahren vor, dessen Anwendung eine sichere Abschätzung der Böschungssicherheit erlaubt. x | |||||
| Grabe, Jürgen | Zur Genauigkeit geotechnischer Prognosen | geotechnik | 4/2013 | 203 | Editorial |
| Rabenstein, D. | Zur Genauigkeit von Heizwärme-Bilanzverfahren. Einführung eines Heizperiodenbilanzverfah-rens mit analytischen Klimafunktionen | Bauphysik | 3/2004 | 128-142 | Fachthemen |
KurzfassungMit geglätteten harmonischen Verläufen der Außentemperatur und der Strahlungsintensitäten lassen sich Heizzeit, mittlere Außentemperatur und Globalstrahlung in der Heizperiode als Funktionen der Heizgrenztemperaturen angeben. Bei Vernachlässigung der zeitlichen Verschiebung zwischen Strahlungsintensitäten und Außentemperatur läßt sich auch die gemittelte Heizgrenztemperatur als einfache Funktion der Gebäudeparameter und der Klimagrößen darstellen. Vergleiche bei kleinen Wärmegewinnen zeigen, daß beim Monatsbilanzverfahren und noch ausgeprägter beim Heizperiodenbilanzverfahren nach EN 832 eine Tendenz zur Unterschätzung des Jahres-Heizwärmebedarfs von Gebäuden besteht, die sich umso stärker auswirkt, je kleiner die Heizzeit ist. Bei kürzeren Heizzeiten als 4 Monaten pro Jahr steht sogar die Eignung des Monatsbilanzverfahrens als Referenzverfahren in Frage. Das analytische Bilanzverfahren, ein einfaches, vollständig analytisches Heizperiodenbilanzverfahren zur Berechnung des Heizwärmebedarfs für unterschiedliche energetische Standards wird vorgestellt. Die erreichbare Berechnungsgenauigkeit wurde durch Vergleiche mit dem Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 und DIN V 4108-6 ermittelt. Für längere Heizzeiten als 5 Monate pro Jahr weicht der nach diesem Verfahren berechnete Jahres-Heizwärmebedarf bei den meisten praktisch vorkommenden Berechnungsfällen um weniger als 2 % vom entsprechenden Ergebnis des Monatsbilanzverfahrens ab. Das von Loga vorgeschlagene vereinfachte Heizperiodenbilanzverfahren für Gebäude mit unterschiedlichen energetischen Standards wird analysiert und mit dem analytischen Bilanzverfahren verglichen. x | |||||