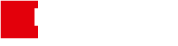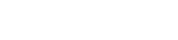Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinke, Tim; Schmidt-Thrö, Gerald; Ummenhofer, Thomas | Entwicklung und Verwendung von externen Kosten für die Nachhaltigkeitsbewertung von Verkehrsinfrastruktur | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2012 | 524-532 | Fachthemen |
KurzfassungInfrastrukturbauwerke zeichnen sich dadurch aus, dass starke Wechselwirkungen zwischen ihnen und ihrer Umgebung bestehen. Beispielsweise ist ein Brückenbauwerk immer in ein Verkehrsnetz eingebunden. Zur Quantifizierung des Umgebungseinflusses wird in der Praxis bereits die Methode der externen Kostenrechnung eingesetzt. Externe Effekte wie Luftverschmutzung und Lärm werden dabei in Geldeinheiten übersetzt und können dadurch direkt in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Eine Integration dieser Methode in die Nachhaltigkeitsbewertung ist allerdings nur möglich, wenn die Potenziale und Probleme der externen Kostenrechnung bekannt sind und auf dieser Grundlage eine Integration in das Gesamtkonzept erfolgt. Der vorliegende Beitrag möchte dafür eine kompakte Grundlage schaffen und erste Empfehlungen für die Systemgestaltung geben. x | |||||
| Zinke, T.; Diel, R.; Mensinger, M.; Ummenhofer, T. | Nachhaltigkeitsbewertung von Brückenbauwerken | Stahlbau | 6/2010 | 448-455 | Fachthemen |
KurzfassungBrückenbauwerke wurden in den vergangenen Jahrzehnten viel zu oft als reine Zweckbauten angesehen und ihre kulturelle Bedeutung sowie die Wechselwirkung mit der Umwelt vernachlässigt. Im Rahmen der aktuellen Ansätze einer ganzheitlichen Bewertung von Baumaßnahmen rücken jetzt viele über den reinen Herstellungspreis hinausgehende Bewertungskriterien in den Vordergrund. Diese sind aber insbesondere für Infrastrukturbauwerke noch nicht vollständig entwickelt. So existiert hier bisher kein ganzheitliches, in sich abgestimmtes System, das ähnlich wie im Hochbau eine Nachhaltigkeitsbewertung ermöglicht. x | |||||
| Zink, U. | Energetische Sanierung eines Baudenkmals - die Villa Seeblick in Heringsdorf | Bauphysik | 6/2005 | 369-373 | Berichte |
| Zink, U. | Gebäudediagnose und Entscheidungskriterien für Ersatzneubauten: Umsetzung am Bauvorhaben Seelow | Mauerwerk | 5/2005 | 176-178 | Fachthemen |
Kurzfassung“Der Mauerwerksbau, ” so Dr. Ronald Rast, Geschäftsführer der DGfM in Berlin, “hat sich in den letzten Jahren signifikant weiterentwickelt. Daraus resultieren neue Anforderungen an alle, die mit Planung und Ausführung von Mauerwerk befaßt sind.” Ziel sei, so Rast weiter, “die aktuellen Änderungen im Rahmen des Kongresses einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen”. x | |||||
| Zimmert, Florian; Braml, Thomas | Freiformbauteile im Stahlbeton-, Spannbeton- und Verbundbau: Berechnung von Querschnittswerten | Beton- und Stahlbetonbau | 5/2023 | 341-352 | Aufsätze |
KurzfassungEin ressourceneffizienter Einsatz des Baustoffs Beton kann erreicht werden, indem die individuelle Form eines betrachteten Bauteils an die auftretenden Beanspruchungen angepasst wird und Verbundbaustoffe (z. B. Betonstahl, Spannstahl oder Baustahl) in geeigneten Bauteilbereichen angeordnet werden. Durch die fortschreitende Digitalisierung im Bauwesen, beispielsweise im Kontext des Building Information Modeling, finden in der Planung von Bauwerken vermehrt computergestützte 3D-Modellierungsverfahren Anwendung. Diese ermöglichen es Ingenieurinnen und Ingenieuren, Bauteile in Freiform zu entwerfen. Im Stahlbeton-, Spannbeton- und Verbundbau ist die Bemessung derartiger Bauteile derzeit noch mit einem großen Aufwand verbunden. Im Kontext der Entwicklung eines praxisgerechten Verfahrens zur Berechnung von Freiformbauteilen aus Beton wird in diesem Aufsatz eine CAD-integrierte Methode zur Berechnung wesentlicher Querschnittswerte vorgestellt. Querschnittswerte werden dann als wesentliche Berechnungsgrundlage benötigt, wenn reale dreidimensionale Bauteile unter Anwendung vereinfachter Berechnungstheorien, wie beispielsweise der Balkentheorie, behandelt werden. In diesem Beitrag werden die mathematischen und numerischen Grundlagen eines Verfahrens vorgestellt, welches es ermöglicht, die Querschnittswerte in Freiform umrandeter Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton- und Verbundbauteile zu berechnen. Dem Verfahren liegen ebene, mittels Non-uniform rational B-Spline Tensor-Produkten beschriebene Flächen zugrunde, welche beispielsweise aus Volumenkörpermodellen extrahiert werden können. x | |||||
| Zimmermann, Welf; Sparowitz, Lutz | Vorgespannte Fertigteile aus Ultrahochfestem Faserbeton | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2012 | 192-200 | Berichte |
KurzfassungSeit der Jahrtausendwende können Bauingenieure bei ihren Objektplanungen den Baustoff Beton in der Form von Ultrahochfestem Beton (UHPC) bzw. Ultrahochfestem Faserbeton (UHPFRC) bei praktischen Bauvorhaben anwenden. Die wissenschaftliche Forschung und materialtechnologische Entwicklung für diesen neuartigen und innovativen Baustoff ist seit diesem Zeitpunkt als Grundlage für Planungen, Ausschreibungen und den praktischen Baustelleneinsatz weitgehend vorhanden. Die ersten Aktivitäten mit ultrahochfestem Beton in Österreich begannen in den Jahren 2005 und 2006 im Süden Österreichs in den Bundesländern Kärnten und Steiermark auf Initiative des Institutes für Betonbau an der TU Graz. Der Schwerpunkt wurde dabei auf die praktische Anwendung für die konstruktive Planung und Bauausführung auf Baustellen gelegt, obwohl es in Österreich derzeit weder anwendbare Normen oder Richtlinien dafür gibt. Die ersten praktischen Anwendungen in Österreich waren Brücken, die mit Unterstützung der Kärntner Landesregierung entstanden. Man erkannte, dass das Material UHPC besonders für die Fertigteilbauweise geeignet ist, weshalb die ersten Brückenkonstruktionen vorwiegend aus Fertigteilen in Kombination mit Spanngliedern geplant und gebaut wurden. Dabei konnte gezeigt werden, dass ein sinnvoller Einsatz eines neuen, aber auch teuren Hochleistungswerkstoffes mithilfe von modernen Montagemethoden wie z. B. dem Segmentklappverfahren dennoch zu wirtschaftlichen, wartungsarmen und architektonisch anspruchsvollen Bauwerken mit langer Lebensdauer führen kann. x | |||||
| Zimmermann, W.; Rostasy, F. S. | Der Reibbeiwert belasteter und unbelasteter feuerverzinkter HV-Verbindungen in Abhängigkeit von der Zeit. | Stahlbau | 3/1977 | 91-94 | Fachthemen |
| Zimmermann, W.; Rostasy, F. S. | Der Reibbeiwert feuerverzinkter HV-Verbindungen in Abhängigkeit von der Nachbehandlung der Zinkschicht. | Stahlbau | 3/1975 | 82-84 | Fachthemen |
| Zimmermann, W. | Der Bau der Stampfgrabenbrücke. Wiederentdeckung der steifen Bewehrung als integriertes Stahllehrgerüst | Beton- und Stahlbetonbau | 4/2004 | 304-310 | Berichte |
| Zimmermann, Torsten | Museum der Bayerischen Könige, Hohenschwangau | Stahlbau | 1/2013 | 61-63 | Berichte |
| Zimmermann, Thomas; Strauss, Alfred | Schubtragverhalten von altem unbewehrtem Mauerwerk unter seismischer Belastung | Bautechnik | 8/2012 | 553-563 | Aufsätze |
KurzfassungDie Bestimmung der Sicherheit von altem Mauerwerk gegen Erdbeben ist mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet. Hierbei kommt es neben dem Widerstand der Struktur und den seismischen Einwirkungen vor allem auf die konstruktiven Details an. Deshalb sind das Verhalten von Mauerwerk unter seismischer Belastung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Tragfähigkeit von hohem Interesse. x | |||||
| Zimmermann, Thomas; Lehký, David; Strauss, Alfred | Correlation among selected fracture-mechanical parameters of concrete obtained from experiments and inverse analyses | Structural Concrete | 6/2016 | 1094-1103 | Technical Papers |
KurzfassungThe correlations among selected parameters of concrete were investigated for concrete mixes of the strength classes C20/25, C25/30, C30/37, C40/50 and C50/60. The focus was laid on correlations between basic mechanical parameters such as compressive strength, tensile strength and modulus of elasticity as well as parameters related to concrete fracture, represented here by specific fracture energy. Laboratory tests examining the fracture behaviour and mechanical properties were carried out in order to determine the fundamental concrete parameters. In particular, standard compression tests on test cubes and three-point bending tests on beams with central edge notch were performed. Additional material parameters were identified using the inverse analysis technique. Finally, correlation factors between different parameters of concrete were identified using the rank-order correlation method. x | |||||
| Zimmermann, Thomas; Friedrich, Henriette Pauline; Strauss, Alfred; Lachinger, Stefan; Binder, Fritz; Gabl, Thomas; Zlatarits, Jakob; Schön, Andreas; Hoffmann, Simon | Entwicklung verschleißarmer Fahrbahnübergangskonstruktionen - Forschungsprojekt EVAF - Schadenserhebung - Sensitivitätsanalyse | Bautechnik | 2/2014 | 91-106 | Aufsätze |
KurzfassungFahrbahnübergangskonstruktionen an Brücken sind aufgrund ihrer Position hochdynamisch belastete Strukturelemente. Fahrbahnübergänge zählen nach Eurocode 0 zu den erneuerbaren strukturellen Komponenten und sollten somit für eine Lebensdauer von zehn bis 25 Jahren und mehr ausgelegt werden. Unabhängig von der Entwurfslebensdauer besteht ein Bedarf, den Erhaltungsaufwand von Fahrbahnübergängen zu minimieren. Das Forschungsprojekt “Entwicklung verschleißarmer Fahrbahnübergangskonstruktionen” (EVAF) hat daher die Zielsetzung, auf Basis umfangreicher Schadenserhebungen, Literaturstudien und numerischer Beanspruchungsanalysen die Ursachen für frühzeitige Schäden zu ermitteln und in Folge für einzelne Typen von Fahrbahnübergangskonstruktionen innovative Lösungen zur Verringerung des Erhaltungsaufwandes und zur Schadensvermeidung zu entwickeln. Es sollen robuste, wartungsarme und mit geringem Aufwand instand zu setzende Fahrbahnübergangskonstruktionen (FÜK) entwickelt werden. Dieser Beitrag zeigt die Erkenntnisse, welche in den beiden ersten Arbeitspaketen (AP1 und AP2) aus den Erhebungen und numerischen Analysen, welche durch das intensive Zusammenwirken der Auftraggeber BMViT, ASFINAG, ÖBB, dem industriellen Partner Mageba und den Forschungspartnern AIT (Austrian Institute of Technology) und der Universität für Bodenkultur im Zuge der Forschungsinitiative vif2012 gewonnen werden konnten. x | |||||
| Zimmermann, T.; Strauss, A. | Gründerzeit-Mauerwerk unter Erdbebenbelastung - Vergleich zwischen normativen Ansätzen und messtechnischen Ergebnissen | Bautechnik | 9/2010 | 532-540 | Fachthemen |
KurzfassungDas Bauen mit Mauerwerk beruht auf Erfahrungen aus vielen Jahrhunderten. Obwohl diese Bauweise weltweit Anwendung findet, ist die Kenntnis über das Materialverhalten von Mauerwerk bis heute mit Unsicherheiten behaftet. x | |||||
| Zimmermann, T. | Structural and Stress Analysis (Ye, J.) | Beton- und Stahlbetonbau | 2/2009 | 132 | Bücher |
| Zimmermann, St.; Kleinman, C. S.; Hordijk, D. A. | Gefügebasierte Stoffbeziehungen für zementgebundene Partikelwerkstoffe - Homogenisierung heterogener Stoffsysteme | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2005 | 705-719 | Fachthemen |
KurzfassungHomogenisierungsmethoden werden in der Verbundwerkstoffforschung zur Herleitung von für den heterogenen Werkstoff repräsentativen "homogenen" Stoffeigenschaften eingesetzt. Im Aufsatz werden, nach einer Übersicht der neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet, zunächst allgemeine Grundlagen der Homogenisierung heterogener Stoffsysteme vorgestellt und insbesondere hinsichtlich zementgebundener Partikelwerkstoffe ausgeführt. Es wird eine geometrieorientierte Idealisierung des für solche Materialien typischen Gefüges vorgenommen und geschlossene analytische Lösungen für den Kompressions- und Schubmodul beziehungsweise den Elastizitätsmodul und die Querdehnzahl angegeben. Auf dieser Grundlage werden die Auswirkungen der federführenden Gefügecharakteristika auf die effektiven linear-elastischen Eigenschaften diskutiert und Folgerungen für die moderne Betontechnologie gezogen. Abschließend wird ein Ausblick gegeben auf die Möglichkeiten der Homogenisierung, die nichtlinearen Eigenschaften von Verbundwerkstoffen zu behandeln. x | |||||
| Zimmermann, St.; Kessler-Kramer, Ch.; Rutten, H. S. | Neues Verbundwerkstoffmodell für den Elastizitätsmodul hochfester Betone | Beton- und Stahlbetonbau | 3/2002 | 147-156 | Fachthemen |
KurzfassungDer Beitrag stellt ein neues Verbundwerkstoffmodell zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls vor, das neben den Eigenschaften von Zuschlag und Zementstein die globale geometrische Beziehung der Phasen sowie die Auswirkungen der Verbundzone erfaßt. Das Modell ermöglicht den Entwurf einer Betonzusammensetzung, die den spezifischen Anforderungen an den E-Modul genügt. Die Modellparameter sind einfach zu bestimmen, wodurch anderen Verfahren gegenüber Zeit- und Kostenvorteile entstehen. An praxisüblichen Betonen wird gezeigt, daß die experimentell bestimmten E-Module mit hoher Präzision vorhergesagt werden können. x | |||||
| Zimmermann, St. | Wechselausstellungshalle des Deutschen Historischen Museums in Berlin | Stahlbau | 11/2003 | 814-816 | Berichte |
| Zimmermann, P. | Bemerkungen zur Literatur über Galileo Galilei. | Bautechnik | 1/1982 | 1-7 | |
KurzfassungDie Literatur über Galileo Galilei umfasst mehr als 8000 Titel. Neben der Beschäftigung mit dem Verfahren vor dem päpstlichen Gericht haben die Beiträge auch Galileis Erkenntnisse auf technischem und naturwissenschaftlichem Gebiet, wie "Das Pendel", "Die Kettenlinie" und die Astronomie zum Inhalt. x | |||||
| Zimmermann, P. | Der Balken als longitudinale und transversale Körperschallbrücke zwischen zwei Wänden. | Bautechnik | 11/1971 | 361-370, 421-425 | |
KurzfassungEs wird das Schwingungsverhalten von zweischaligen Wänden (Platten), die untereinander durch ein balkenförmiges Bauteil verbunden sind. Dies gilt zum Beispiel für zweischalige Wohnungstrennwände, bei denen eine in der Fuge verbliebene Mauerlatte als Schallbrücke wirkt. x | |||||
| Zimmermann, M. | Neuere Entwicklung beim Bau von Leuchttürmen aus Kunststoffen. | Bautechnik | 9/1977 | 316-319 | |
KurzfassungÜber die Anwendung von glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) beim Bau von Leuchttürmen. x | |||||
| Zimmermann, Josef; Reiser, Maximilian | Prognose des Verbrauchs grauer Energie über die Lebensdauer von Gebäuden | Mauerwerk | 3/2021 | 120-131 | Berichte |
KurzfassungDas Bauen in Städten und Ballungsräumen gehört weltweit zu den größten Ressourcenverbrauchern. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Deutschland stellt Anforderungen an den energetischen Standard für den Neubau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Reduktion des Primärenergiebedarfs für die Wärmeversorgung im Betrieb. Die erforderliche nicht erneuerbare Primärenergie (graue Energie) der in Gebäuden eingesetzten Materialien und der damit einhergehende Ressourcenverbrauch ist jedoch zusätzlich zu beachten. Die bei der Errichtung von Gebäuden umgesetzte graue Energie wurde bereits vielfach untersucht und beschrieben. Dieser Beitrag befasst sich mit der anfallenden grauen Energie über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien. Insbesondere werden die Aufwendungen nach der Errichtung für Instandsetzung und Entsorgung untersucht. Hierzu wird ein Prognosemodell auf Basis der Methodik der Standardraumstrukturen von Kornblum und Greitemann entwickelt und auf das Beispiel einer Wohnimmobilie angewandt. x | |||||
| Zimmermann, Josef; Reiser, Maximilian | Prognose des Verbrauchs grauer Energie über die Lebensdauer von Gebäuden | Bautechnik | 1/2021 | 63-73 | Aufsätze |
KurzfassungDas Bauen in Städten und Ballungsräumen gehört weltweit zu den größten Ressourcenverbrauchern. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Deutschland stellt Anforderungen an den energetischen Standard für den Neubau. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Reduktion des Primärenergiebedarfs für die Wärmeversorgung im Betrieb. Die erforderliche nicht erneuerbare Primärenergie (graue Energie) der in Gebäuden eingesetzten Materialien und der damit einhergehende Ressourcenverbrauch ist jedoch zusätzlich zu beachten. Die bei der Errichtung von Gebäuden umgesetzte graue Energie wurde bereits vielfach untersucht und beschrieben. Dieser Beitrag befasst sich mit der anfallenden grauen Energie über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien. Insbesondere werden die Aufwendungen nach der Errichtung für Instandsetzung und Entsorgung untersucht. Hierzu wird ein Prognosemodell auf Basis der Methodik der Standardraumstrukturen von Kornblum und Greitemann entwickelt und auf das Beispiel einer Wohnimmobilie angewandt. x | |||||
| Zimmermann, H. | Persönliches: Bautechnik 10/2010 | Bautechnik | 10/2010 | 661-662 | Nachrichten |
| Zimmermann, H. | Neues Berechnungsverfahren für grabenverlegte Rohre mit elastischer Bettung. | Bautechnik | 9/1995 | 608-617 | Fachthemen |
KurzfassungBehandelt werden die interaktiven Vorgänge zwischen Rohr- und Bodenverformungen und dem Kräftegleichgewicht zwischen aktiver Erddruckbelastung und Bettungsreaktionsbruch infolge von Rohrverformungen. Dabei werden die tatsächlichen, sehr vielfältigen Beziehungen im Rohrgraben berücksichtigt. Es werden iterativ mit Hilfe von Differentialgleichungen die lagenweise Verfüllung des Rohrgrabens, die bereits vor der Verfüllung stattgefundene Eigengewichtssetzung des Bodenkörpers neben dem Graben sowie die Querkraftverteilung innerhalb des Rohrgrabens durch ein Rechenprogramm wirklichkeitsnah erfaßt. x | |||||