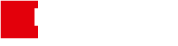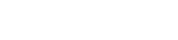| Köster, Helmut; Stephan, Andreas; Wolfrath, Elias; Weismann, Stephan | Tageslichtlenksysteme mittels Spiegeloptiken | Bauphysik | 3/2022 | 172-178 | Berichte |
Die Tageslichttechnik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet zwischen Bauphysik und Lichttechnik und verwirklicht mittels neuartiger Spiegeloptiken verbesserte Schutzfunktion vor Überhitzung, jedoch gleichzeitiger Versorgungsfunktion mit natürlichem Tageslicht, wodurch eine Gesamtenergieeinsparung von verglasten Gebäuden von bis zu 30 % ermöglicht wird. Im Rahmen des Green Deals wird von der EU-Kommission eine Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) angestoßen, die Teil eines umfassenden Gesetzespaketes mit der ambitionierten Zielsetzung ist, emissionsfreie Gebäude zu definieren und damit die Reduktion der CO2- Emissionen in Europa voranzutreiben. Die Tageslichtumlenktechnik, die im Winter solare Zugewinne, im Sommer einen Schutz vor Überhitzung und ganzjährig die Tageslichtautonomie fördert, kann eine ganz wesentliche Rolle in der Umsetzung dieser ehrgeizigen Ziele spielen. In diesem Beitrag wird eine neue Tageslichtumlenktechnik vorgestellt, mit der sich auch mittels eines innenliegenden Behangs ein gges-Wert von 0, 05 sogar in offener und durchsichtiger Lamellenlage mit Tageslichteintrag realisieren lässt.
Daylight control systems using mirror optics
Daylighting is an interdisciplinary field between building physics and lighting technology and implements improved protection against overheating by means of novel mirror optics developed, while at the same time providing daylight, thus enabling total energy savings of glazed buildings of up to 30 %. As part of the Green Deal, the EU Commission is initiating a directive on the energy performance of buildings (EPBD), which is part of a comprehensive legislative package with the ambitious goal of defining zero-emission buildings and thus driving forward the reduction of CO2 emissions in Europe. Daylight guiding technology, which enables solar gains in winter, prevents overheating in summer and enables daylight autonomy all year round, can play a very important role in the implementation of these ambitious goals. In this essay a new daylight guiding technology will be presented, with which a total solar energy transmittance gtot of 0.05 can be realised even in open and transparent slat positions with daylight input by means of internal blinds. x |
| Bauphysik Aktuell 3/2022 | Bauphysik | 3/2022 | 179-186 | Bauphysik Aktuell |
Die Brandkatastrophe Grenfell Tower vor fünf Jahren
BuGG-Gründach des Jahres 2021 Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie
Sozial und klimafreundlich: Vorlesungen über geförderten Wohnungsbau
fischer und das Vitra Design Museum blicken auf die Welt des Plastiks
Geteiltes Wissen: Arbeitshilfen für die BIM-Anwendung
Neue Broschüre der Ziegelindustrie zum Schallschutz nach DIN 4109
Internationales Jahr des Glases 2022
Braunschweiger Brandschutz-Tage 2022
17. Internationale Konferenz zur Gebäudehülle der Zukunft mit Thema Brandschut x |
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 3/2022 | 186 | Veranstaltungen |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Titelbild: Bauphysik 2/2022 | Bauphysik | 2/2022 | | Titelbild |
Zum Titelbild:
Der Beitrag des Teams RoofKIT zum Solar Decathlon Europe SDE 21/22 ist die Aufstockung auf ein Bestandsgebäude, um neue Funktionen und Wohnraum zu schaffen (siehe S. 57). Hauptzielsetzungen sind das sortenreine und kreislaufgerechte Bauen sowie eine CO2-neutrale solargestützte Energieversorgung. Das Bestandsgebäude bleibt äußerlich als Identifikationspunkt im Quartier weitgehend unverändert unter energetischer Aufwertung der Gebäudehülle; u. a. werden die Bestandsfenster durch eine zweite Fensterebene aus der urbanen Mine ergänzt. Der neu gestaltete Ballsaal wird um ein Geschoss nach oben versetzt. Der dadurch gewonnene Raum des ehemaligen Tanzsaals wird zu Unterkünften für internationale Künstler und andere temporäre Bewohner umgestaltet. Die Aufstockung weiterer Wohneinheiten auf den neuen Tanzsaal wird in vorgefertigten Holzmodulen ausgeführt. Das Bild zeigt eine Visualisierung. (Quelle: Team RoofKIT).
x |
| Inhalt: Bauphysik 2/2022 | Bauphysik | 2/2022 | | Inhalt |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Voss, Karsten | Was hat ein studentischer Gebäude-Energie-Wettbewerb mit Bauforschung zu tun? | Bauphysik | 2/2022 | 55-56 | Editorial |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Wagner, Andreas; Carbonare, Nicolas; Knudsen, Mattis; Hebel, Dirk. E.; Gebauer, Regina; Blümke, Katharina | RoofKIT - Auf dem Weg zu einem neuen Bauen | Bauphysik | 2/2022 | 57-63 | Berichte |
Der Beitrag des Teams RoofKIT zum SDE 21/22 ist die Aufstockung auf ein Bestandsgebäude, um neue Funktionen und Wohnraum für das Gebäude zu schaffen bei gleichzeitiger energetischer Aufwertung. Hauptzielsetzungen sind das sortenreine und kreislaufgerechte Bauen sowie eine CO2-neutrale solargestützte Energieversorgung. Im Fokus dieses Berichts stehen die Konstruktion der Gebäudehülle einer Demoeinheit sowie deren passive Kühlung durch Nachtlüftung.
RoofKIT - on the way to a new building philosophy
The contribution of the RoofKIT team to the SDE 21/22 is the extension for an existing building to create new functions and living space for the building with simultaneous energetic upgrading. Main targets are mono-fraction and cycle-based building, as well as a CO2-neutral solar-based energy supply. This article focuses on the construction of the building envelope of a demo unit as well as its passive cooling by night ventilation. x |
| Pichlhöfer, Alexander; Fischer, Henriette; Wimmer, Werner; Korjenic, Azra | Untersuchung des Feuchteeintrags in erdberührtes Ziegelmauerwerk durch die Bewässerung von Kletterpflanzen | Bauphysik | 2/2022 | 64-72 | Aufsätze |
Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Projekt “Feuchteeinträge in die Außenwandkonstruktion von Untergeschossen aufgrund von Kletterpflanzen wurden im Folgeprojekt detaillierte Untersuchungen zur Feuchtigkeit in Ziegelmauerwerk im Zusammenhang mit Kletter-pflanzen durchgeführt. Vier Prüfstande, welche eine erdberührte Kellerwand aus Ziegel simulieren sollten, wurden konstruiert. Um Auswirkungen der Begrünung zu erfassen, wurde die Feuchtigkeit im Erdreich (Substrat) und im Ziegelmauerwerk kontinuierlich gemessen. Um Unterschiede zwischen verschiedenen Pflanzen untersuchen zu können, wurden drei der Prüf-stände mit verschiedenen Kletterpflanzen bepflanzt und der vierte Prüfstand als Referenz ohne Bepflanzung verwendet. Bei der Auswertung wurde die Feuchtigkeit im Substrat und des Ziegelmauerwerks verglichen. Die Kletterpflanzen haben grundsätzlich für eine geringere Feuchtigkeit in Substrat und Mauerwerk gesorgt, gleichzeitig konnte kein direkter Zusammen-hang zwischen den gemessenen Parametern festgestellt werden. Bei im Vergleich höherer Feuchtigkeit im Substrat liegt nicht zwangsläufig höhere Feuchtigkeit im Mauerwerk vor. Die vorgefundene Feuchtigkeit im Mauerwerk wurde anschließend in Anlehnung an ÖNORM B 3355 bewertet. Zusätzlich wurde für das verwendete Substrat und die verwendeten Ziegel die Saugspannungskurve mithilfe von Drucktopf-Extraktoren bestimmt und ausgewertet.
Investigation of moisture penetration into brick masonry in contact with soil, due to irrigation of climbing plants
Based on the results of the project “Moisture ingress into the exterior wall construction of basements due to climbing plants”, the moisture in brick masonry in connection with climbing plants was investigated. Four test stands, which were to simulate a brick basement wall in contact with the ground, were constructed. The moisture content in the soil and the brick masonry was measured. Three of the test stands were each planted with a different climbing plant and the fourth test stand served as reference without planting. The climbing plants basically provided lower moisture in the substrate and brickwork, but no direct correlation could be established. Higher humidity in the substrate does not necessarily mean higher humidity in the masonry. The moisture found in the masonry was then evaluated in accordance with ÖNORM B 3355. In addition, the suction stress curve was determined for the substrate and bricks used, with the aid of pressure pot extractors. x |
| Eßer, Georg; Keil, Moritz | Schalldämmung mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden | Bauphysik | 2/2022 | 73-85 | Aufsätze |
Bereits in den Jahren 1992 bis 1994 wurden über 30 Eignungs- und Baumusterprüfungen an vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) im Prüfstand der ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH durchgeführt. Damals wurde bei den Messungen eine 60 mm und eine 120 mm dicke Wärmedämmung verbaut. Da sich im Zuge der fortschreitenden Anforderungen an die Energieeinsparung die Dicken der Wärmedämmung erhöht haben, wurden erneut über 40 Messungen der Luftschalldämmung im Labor der ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH an vorgehängten hinterlüfteten Fassaden vorgenommen. Hierbei erfolgten die meisten Messungen mit einer Mineralwolldämmung in einer Dicke von d = 180 mm. Weiterhin hat sich die Vielfalt an Fassadenbekleidungen sowie Befestigungssystemen vergrößert, was die Notwendigkeit einer Neuauflage nochmals unterstreicht. Da in der DIN 4109-34:2016-07 “Schallschutz im Hochbau - Teil 34: Daten für die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen” noch keine Ausarbeitungen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden vorliegen, können die hier vorgestellten Messergebnisse auch für die Planung des Schallschutzes gegenüber Außenlärm in Verbindung mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden eine erste Hilfestellung bieten.
Sound insulation with rear-ventilated rainscreen façades
As early as 1992-1994, more than 30 suitability and type tests on rear-ventilated rainscreen façades were carried out in the test stand of ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH. At that time, 60 mm and 120 mm thick thermal insulation was used for the measurements. Since the thickness of the thermal insulation has increased in the course of progressive requirements for energy saving, more than 40 measurements of the airborne sound insulation were again carried out in the laboratory of ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH on rear-ventilated rainscreen façades. Most of the measurements were carried out with mineral wool insulation with a thickness of d = 180 mm. Furthermore, the variety of façade claddings and fastening systems has increased, which again underlines the necessity of a new measurement campaign. Since DIN 4109-34:2016-07 “Sound insulation in buildings - Part 34: Data for the analytical verification of sound insulation (component catalogue) - Facing constructions in front of solid building components” does not yet contain any elaborations for rear-ventilated rainscreen façades, the measurement results presented in this article provide useful information for the planning of sound insulation. x |
| GlasHandbuch 2022 erschienen | Bauphysik | 2/2022 | 85 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Neusser, Maximilian; Dolezal, Franz | Prognose der Schalldämmung von Außenwänden mit Wärmedämm-Verbundsystem - Entwicklung des Prognoseverfahrens als Beitrag zur Überarbeitung der ÖNORM B 8115-4 | Bauphysik | 2/2022 | 86-94 | Aufsätze |
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) stellen nicht nur eine kostengünstige Möglichkeit der Reduktion des Wärmeverlustes durch Außenwände dar, sondern haben, je nach Material, auch Auswirkungen auf das Schalldämm-Maß dieser Bauteile. Das vorliegende Prognosemodell für das bewertete Schalldämm-Maß von Außenwänden mit WDVS wurde in dieser Form in die derzeit in Überarbeitung befindlichen österreichischen bauakustischen Prognosenorm ÖNORM B 8115-4 aufgenommen und stellt deren derzeitigen Bearbeitungsstand dar. Das erwähnte Modell bedeutet nicht nur einen signifikanten Sprung in der Prognosegenauigkeit, sondern führt erstmals auch alle wesentlichen, in Österreich gebräuchlichen, Massivwände in ein Modell zusammen. Es ist damit möglich, das bewertete Schalldämm-Maß von Außenwänden aus Ziegel, Beton und Massivholz mit WDVS in einfacher und transparenter Weise zu berechnen. Darüber hinaus ermöglicht das Modell auch die Ermittlung des Spektrum-Anpassungswertes Ctr des Schalldämm-Maßes, wodurch die Eignung des Außenbauteils zum Schutz vor Verkehrslärm durch den Planer charakterisierbar wird. Das vorliegende, materialübergreifende Prognosemodell resultiert aus der Zusammenführung früherer, materialspezifischer Forschungsarbeiten der beiden Autoren zu diesem Thema.
Prediction of sound insulation of external walls with external thermal insulation compound system - Development of a prediction model for light and heavy massive basic walls as contribution to the revision of ÖNORM B 8115-4
External thermal insulation compound systems (ETICS) are not only a cheap opportunity to reduce thermal losses through external walls, but have, depending on the material, a significant impact on the weighted sound reduction index of these building components as well. The prediction model at hand for the weighted sound reduction index of external walls has already been adopted into the revision of the Austrian standard for acoustic prediction methods, ÖNORM B 8115-4, representing the present status. The mentioned model not only implies a significant leap in accuracy, but also addresses all massive walls commonly used in Austria for the first time. It can be applied for the prediction of the weighted sound reduction index of external walls made from concrete, bricks or mass timber in a simple and transparent way. Moreover, it can be used for prediction of the spectrum adaptation term Ctr, which is of importance for the characterisation of the traffic noise frequency spectrum. The presented comprehensive prediction model results from the combination of previous material specific research activities of the authors to this topic. x |
| Röseler, Holger; Krause, Pia; Eitle, Adrian; Veres, Eva; Leistner, Philip | Bauhaus und Bauphysik - Eine bauphysikalische Untersuchung und Bewertung am Beispiel Haus Oud | Bauphysik | 2/2022 | 95-105 | Aufsätze |
Während aktuell das Neue Europäische Bauhaus mit einer interdisziplinären Ausrichtung die zukünftige Gestaltung unserer Lebens- und Bauweisen in den Blickpunkt rückt, fielen vor wenigen Jahren zwei Jubiläen zusammen. 100 Jahre waren seit der Bauhaus-Gründung vergangen und 90 Jahre seit der Gründung eines der ersten Forschungsinstitute mit dem Schwerpunkt Bauphysik. Natürlich trennt beide Institutionen nicht nur ein 10-jähriger “Altersunterschied”. Mit dem historisch einzigartigen Bauhaus ist die anfangs sehr kleine Stuttgarter Gruppe bauphysikalischer Enthusiasten nicht zu vergleichen. Rückblickend lassen sich aber Ähnlichkeiten der Motive beider Initiativen konstatieren und es ist anzunehmen, dass beim “Neuen Bauen” von Anfang an auch Überlegungen in den Entwurfsprozess einflossen, die der Bauphysik zentrale Fragestellungen und wichtige Impulse mit auf den Weg gaben. Diese Beziehung zwischen Bauhaus und Bauphysik wird am Beispiel des Reihenhauses Oud in der Weißenhofsiedlung in Stuttgart untersucht.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Bausubstanz im Reihenhaus Oud eine deutlich schlankere Konstruktion als Vergleichsbauten seiner Zeit aufwies. Die daraus resultierenden bauphysikalischen Auswirkungen, mit Fokus auf den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz, werden analysiert. In Summe stellte das Haus Oud einen wertvollen Beitrag zur Erforschung und Weiterentwicklung von kostengünstigen, innovativen Wohnformen dar und war prägend für zukünftige Bauprozesse bis in die Gegenwart.
Bauhaus and building physics - A building physics analysis using the example of House of Oud
While the New European Bauhaus is currently focusing on the future design of our ways of living and building with an interdisciplinary orientation, two anniversaries coincided a few years ago. 100 years have passed since the founding of the Bauhaus and 90 years since the founding of one of the first research institutes focusing on building physics. The two institutions are not only separated by a 10-year “age difference”. The initially Stuttgart group of building physics enthusiasts cannot be compared with the historically unique Bauhaus. Retrospective, however, similarities in the motives of both initiatives can be observed, and it can be assumed that, from the very beginning, the Bauhaus also incorporated considerations into the design process that gave building physics central questions and important impulses along the way. This relationship between Bauhaus and building physics is investigated using the example of the house Oud in the Weißenhofsiedlung in Stuttgart. x |
| Bauphysik Aktuell 2/2022 | Bauphysik | 2/2022 | 107-111 | Bauphysik Aktuell |
Persönliches:
Zum Tod von Eberhard Schöck
Aktuell:
Deutscher Ingenieurbaupreis 2022 ausgelobt
ift-Richtlinie FE-18/1 Öffnungsbegrenzer
Modernisierte Prüfhalle für Bauakustik beim PfB
Wegweiser durch die Klima- und Lüftungsbranche des FGK
Whitepaper “BIM und Brandschutz” der buildingSMART-Fachgruppe
Modulare Weiterbildung in Bauphysik und energetischer Gebäudeoptimierung mit CAS x |
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 2/2022 | 112 | Veranstaltungen |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Bauphysik: Inhaltsverzeichnis des 43. Jahrgangs 2021 | Bauphysik | 1/2022 | | Jahresinhaltsverzeichnis |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Inhalt: Bauphysik 1/2022 | Bauphysik | 1/2022 | | Inhalt |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Titelbild: Bauphysik 1/2022 | Bauphysik | 1/2022 | | Titelbild |
Zum Titelbild:
FORESTA - also Ital. für “Wald” - wurde in einer Kooperation zwischen Arup und dem italienischen Biodesgin-Unternehmen Mogu entwickelt und bringt ein Stück Natur in die Büros. Es handelt sich dabei um ein regeneratives Akustiksystem mit dem Büros für die neue Arbeitswelt nachhaltig umgestaltet werden können. Diese Alternative zu Polyesterschäumen oder Verbundstoffen basiert auf Myzel, dem wurzelähnlichen Gewebe von Pilzen, das auf einem Substrat aus Baumwoll- und Hanfresten kultiviert wird. Dadurch fungiert das System als CO2-Speicher und senkt so den ökologischen Fußabdruck beim Innenausbau deutlich. (awp/Filippo Piantanida)
x |
| Stelzmann, Mario; Kirschke, Marcus; Fricke, Marc; Tietze, Matthias; Kahnt, Alexander | Validierung eines Polyurethan-basierten Aerogels im Realbetrieb | Bauphysik | 1/2022 | 1-8 | Aufsätze |
Mit steigenden Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden werden immer leistungsfähigere Dämmstoffe entwickelt. Die Technologie der Aerogele erreicht dabei besonders niedrige Wärmeleitfähigkeiten aufgrund ihrer Porengrößen im Nanometerbereich. Während sich Aerogele prinzipiell aus verschiedenen Ausgangsstoffen herstellen lassen, wird in diesem Artikel das Verhalten eines Aerogels auf Basis von Polyurethan unter realen Bedingungen untersucht. Der Einbau des Aerogels erfolgte in einem Wandelement, in der Dachterrasse und in Fensteranschlüssen eines Gebäudes. Auf Basis von Messdaten eines einjährigen Monitorings wurden die verschiedenen Anwendungen in hygrothermischen Simulationsmodellen validiert.
Validation of a polyurethane-based aerogel in practical use
Due to the increase of energy efficiency requirements for buildings, more efficient insulating materials are developed. The technology of aerogels achieves particularly low thermal conductivities with their pore sizes in the nanometer range. While aerogels can be manufactured from various materials, the behavior of a polyurethane-based aerogel under real conditions is analyzed in this article. The aerogel was installed in a wall element, the roof terrace and window connections of a building. With measurement data from one year of monitoring, the various applications were validated in hygrothermal simulation models. x |
| dena-Studie zu thermischen Energiespeichern in Quartieren | Bauphysik | 1/2022 | 8 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Latz, Sebastian; Scholzen, Frank; Thewes, Andreas; Maas, Stefan | Comparison of high-performance and conventional internal insulation materials based on hygrothermal analysis using in situ measurements and simulation | Bauphysik | 1/2022 | 9-20 | Aufsätze |
Following the European directive to reduce CO2 emissions of existing buildings by improving energy efficiency, internal insulation systems play a central role in the renovation of historically valuable buildings which cannot be insulated from the outside for reasons of monumental protection, or in cases where no additional exterior space is available. However, besides the thermal property of insulation systems, there are other relevant properties to be considered before choosing an internal insulation system, such as the hygrothermal behavior which plays a particularly important role in diffusion-open interior insulation systems. As the internal insulation layer reduces the temperature of the existing wall during the heating season, its drying potential after rain events is considerably reduced. In addition to the effects of moisture from the outside (mainly wind driven rain), the entry of humidity from the inside through diffusion plays an important role. In the presented study, high performance insulation materials with nanostructure based on silicon dioxide and polyurethane are compared to conventional material based on wood fiber from a hygrothermal point of view by analyzing in situ measurements and simulations.
Vergleich von Hochleistungsdämmstoffen mit einem konventionellen Innendämmstoff auf der Grundlage einer hygrothermischen Analyse mit In-situ-Messungen und Simulation
Im Zuge der europäischen Richtlinien zur Senkung der CO2-Emissionen bestehender Gebäude durch Verbesserung der Energieeffizienz spielen Innendämmsysteme eine zentrale Rolle bei der Sanierung historisch wertvoller Gebäude, die aus Gründen des Denkmalschutzes nicht von außen gedämmt werden können, oder in Fällen, in denen keine zusätzlichen Außenflächen zur Verfügung stehen. Neben der wärmetechnischen Eigenschaft von Dämmsystemen gibt es jedoch noch weitere relevante Eigenschaften, die bei der Auswahl eines Innendämmsystems zu berücksichtigen sind, wie z. B. das hygrothermische Verhalten, das insbesondere bei diffusionsoffenen Innendämmsystemen eine wichtige Rolle spielt. Da die Innendämmschicht die Temperatur der bestehenden Wand während der Heizperiode absenkt, wird ihr Trocknungspotenzial nach Regenereignissen erheblich reduziert. Neben den Feuchteeinflüssen von außen (vor allem durch Schlagregen) spielt auch der Feuchteeintrag von innen durch Diffusion eine wichtige Rolle. In der vorgestellten Untersuchung wurden Hochleistungsdämmstoffe mit Nanostruktur auf Basis von Siliziumdioxid und Polyurethan mit einem konventionellen Dämmmaterial auf Basis von Holzfasern aus hygrothermischer Sicht verglichen, indem In-situ-Messungen und Simulationen analysiert wurden. x |
| vdd vereint nun Bitumenbahnen- und Kunststoffbahnenhersteller | Bauphysik | 1/2022 | 20 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Häusler, Clemens; Lechner, Christoph | ÖNORM B 8115-2: Methodik zur Ermittlung von Schallschutzniveaus | Bauphysik | 1/2022 | 21-27 | Aufsätze |
Im Jahr 2018 wurde der final draft von ISO FDIS 19488 “Akustisches Klassifizierungssystem für Wohngebäude”, eine Klassifizierung mit konkreten Zahlenwerten, von den Mitgliedsstaaten abgelehnt. Aus Sicht der Autoren zu Recht, denn nicht wertemäßig einheitliche Anforderungen, sondern eine einheitliche Methodik sollte das Ziel internationaler Harmonisierung sein. 2021 erschien inhaltlich unverändert ISO TS 19488 als “Technical Specification”, also abgewertet als “Technische Regel”.
Weltweit den gleichen Schallschutz zu fordern oder zu empfehlen ist genauso unrealistisch wie technisch fragwürdig. Nicht gleiche Anforderungen, sondern gleiche Verfahren sind gefragt. Die neue ÖNORM B 8115-2 präsentiert eine solche einheitliche Methodik, die absolute Höhe des Anforderungsniveaus kann entsprechend den jeweiligen Vorstellungen der “Schutzziele” festgelegt werden.
ÖNORM B 8115-2: Methodology for the determination of sound insulation levels
In 2018, the final draft of ISO FDIS 19488 “Acoustic Classification System for Residential Buildings”, a classification with concrete numerical values, was rejected by the member states. From the authors' point of view, rightly so, because the aim of international harmonization should not be uniform requirements in terms of values, but a uniform methodology. In 2021, ISO TS 19488 appeared unchanged, as a “Technical Specification”, the same standard devalued as a “Technical Specification”.
Demanding or recommending the same sound insulation worldwide is just as unrealistic as it is technically sensitive. Not the same requirements, but the same procedures are required. The new ÖNORM B 8115-2 presents such a uniform methodology, the absolute level of the requirement can be determined according to the desired sound insulation. x |
| Jahrbuch Ingenieurbaukunst 2022 | Bauphysik | 1/2022 | 28 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Freudenberg, Peggy; Budny, Oda | Grenzen der Verfahren zur Bewertung des Sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2:2013 | Bauphysik | 1/2022 | 29-39 | Aufsätze |
Die Methodik der DIN 4108-2 zur Bewertung der Überhitzungswahrscheinlichkeit eines kritischen Raumes entspricht nicht mehr den wissenschaftlichen und technischen Standards. Die Kritik in der Fachliteratur hat zugenommen. Im vorliegenden Artikel werden die Hintergründe der DIN 4108-2 erläutert und bekannte Anwendungsgrenzen und Unzulänglichkeiten aus der Literatur zusammengefasst. Diese betreffen sowohl angenommene Randbedingungen als auch die Abbildung der relevanten physikalischen Effekte und Bewertungsgrößen. Darüber hinaus wird dargelegt, dass Gebäudenutzung, Raumeigenschaften und Klima als relevante Kategorien in der Betrachtung des Überhitzungsrisikos differenzierter abgebildet werden müssen. Anhand von fünf Praxisbeispielen werden Widersprüche zwischen Ergebnissen des vereinfachten Sonneneintragskennwerte-Verfahrens, Simulationen mit Randbedingungen gemäß DIN 4108-2 und Simulationen mit gebäudespezifischen Randbedingungen aufgezeigt. Anhand eines Vergleiches von Mess- und Simulationsergebnissen für einen dieser Beispielräume werden auch Grenzen der Simulationsrechnungen angesprochen. Ziel der Darstellung ist es, zwischen der wissenschaftlichen Diskussion, die von stark idealisierten Fällen getragen ist, und den planerischen Herausforderungen der Praxis, in welcher die Anwendbarkeit dieser Nachweisansätze oft unklar ist, zu vermitteln.
The limitations of the overheating risk assessment procedures according to DIN 4108-2:2013
The methodology of DIN 4108-2 for assessing the overheating probability of a critical room no longer reflects scientific and technical standards. There is increasing criticism in the literature. The article explains the methodology and background of DIN 4108-2 and summarizes known application limits and shortcomings from the literature. These concern both assumed boundary conditions and the representation of the relevant physical effects and assessment criteria. Furthermore, the paper claims that the building use and geometry must be integrated in a more differentiated manner as a relevant category in the consideration of the overheating risk. On analyzing five practical examples, contradictions between the results of the simplified method, the simulations with boundary conditions according to DIN 4108-2 and the simulations with building-specific boundary conditions are shown. By means of a comparison of measurement and simulation results for one of these example rooms, the limitations of the simulation analyses are also addressed. The aim of this illustration is to mediate between the scientific discussion, which is based on highly idealized cases, and the practice-related planning challenges, where the applicability of these assessment approaches is often unclear. x |
| Neue Richtlinien zur Brandschadensanierung und zur Wasserschadentrocknung der Holzforschung AUSTRIA | Bauphysik | 1/2022 | 39 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |