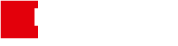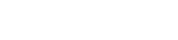Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Glitza, H.; Jäger, W.; Burkert, T. | Zur Haftscherfestigkeit bei Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen | Mauerwerk | 3/2006 | 102-111 | Fachthemen |
KurzfassungDie Anforderungswerte für Haftscherfestigkeit im Anhang A von DIN 1053-1 beziehen sich auf das Prüfverfahren nach DIN 18555-5 unter Verwendung eines Kalksandsteins als Referenzstein. In der Literatur werden für Leichtbetonsteine demgegenüber deutlich höhere Haftscherfestigkeiten angegeben. Die dort zu findenden Werte sind jedoch teilweise mit sehr großen Streuungen behaftet. Im Beitrag wird den Ursachen hierfür nachgegangen und ein Vorschlag für eine Anpassung der Anforderungs- und Rechenwerte für Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen im Rahmen der derzeit laufenden Überarbeitung der DIN 1053-1 unterbreitet. x | |||||
| Friedrich, R. | Zur Harmonisierung der Bemessungsverfahren. | Bautechnik | 4/1993 | 239-240 | Berichte |
| Schwarz, J.; Grünthal, G. | Zur Harmonisierung der seismischen Einwirkungen in Erdbebenbaunormen. | Bautechnik | 11/1993 | 681-693 | Fachthemen |
KurzfassungFragestellungen und aktuelle Anforderungen, die aus der Einschätzung der seismischen Gefährdung und der Beschreibung der zugehörigen Einwirkungen für die Auslegungsrechnung im Zusammenhang mit der Vereinheitlichung des Europäischen Normenwerkes (Eurocode 8) abzuleiten sind, werden diskutiert. Zur Behandlung ausgewählter Probleme werden prinzipielle Vorgehensweisen vorgestellt und hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit zur Harmonisierung der bestehenden Vielfalt in den nationalen Erdbebennormen bewertet. Im Mittelpunkt steht die Umsetzung makroseismischer Informationen in Berechnungsgrößen, wobei zwischen den Möglichkeiten einer gefährdungsbezogenen bzw. gefährdungskonsistenten Einwirkungsbeschreibung unterschieden wird. Die durch den EC 8 zu erwartenden Veränderungen gegenüber der Erdbebennorm DIN 4149 werden herausgearbeitet und durch Spektrumrelationen quatifiziert. Die Ermittlung der Bemessungsspektren wird dabei auf ein Produkt aus frequenzabhängigen Koeffizienten zurückgeführt. x | |||||
| Hechtl, A. | Zur Herstellung von Bohrpfählen in Böden mit geringer Festigkeit. | Bautechnik | 6/1997 | 414 | Berichte |
| Fastabend, M. | Zur ingenieurmäßigen Bestimmung des Steifigkeitsabfalls von Stahlbeton im Zustand II | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2002 | 415-420 | Fachthemen |
KurzfassungEine rasche und nachvollziehbare Kontrolle von mittels handelsüblicher Software ermittelten Schnittgrößen für Hochbauten ist von großer Relevanz für Statiker und Prüfingenieur. Die ingenieurmäßige Abschätzung der Steifigkeiten von gerissenen Stahlbetonbauteilen wird in einfachen Ansätzen beschrieben. x | |||||
| Müller, Werner | Zur inneren Scherfestigkeit von Kunststoff-Dränelementen | geotechnik | 4/2012 | 257-262 | Fachthemen |
KurzfassungKunststoff-Dränelemente werden auch in Böschungen eingebaut. Da sie in der Regel aus mehreren Komponenten, nämlich mindestens aus einem Dränkern und einem Filtervliesstoff bestehen, hängt die Standsicherheit u. a. von der inneren Scherfestigkeit der Produkte ab. Diese kann entweder durch die reine Reibung der Komponenten untereinander oder durch die mechanische Festigkeit von Fügestellen zwischen den Komponenten bedingt sein, die schon bei der Produktion hergestellt werden. Im letzteren Fall ist nicht klar, wie Ergebnisse von Reibungsversuchen im Rahmenschergerät zu interpretieren sind. Vor diesem Hintergrund wird gezeigt, wie die Druck- und Scherkräfte, die ein Produkt langfristig aushalten kann, aus einem Reibungsversuch im Zusammenhang mit Kriechversuchen abgeleitet werden können. Dieses Vorgehen wird bei der Zulassung nach der Deponieverordnung für den Einsatz in Deponieabdichtungen angewendet. x | |||||
| Hauser, C.; Walz, B.; Thienert, C.; Pulsfort, M. | Zur inneren Standsicherheit eines Fangedamms | Bautechnik | 5/2009 | 256-269 | Fachthemen |
KurzfassungAuf der Grundlage der Erkenntnisse aus bodenmechanischen Modellversuchen werden die Gleitflächen identifiziert, die bei einem “inneren” Versagen des Bodenfüllkörpers eines Fangedamms auftreten. Hieraus wird ein neues Verfahren zum Nachweis der inneren Standsicherheit des Bodenfüllkörpers hergeleitet. Die Vorstellung über die Entwicklung der Gleitflächen und damit auch das Nachweisverfahren weichen von denjenigen der Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU, 2004 [3]) ab, die vorschreiben, für den Nachweis der inneren Standsicherheit des Bodenfüllkörpers einerseits den Aufbruch des Bodens nach oben und andererseits die Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge zu untersuchen. Wird die im Grenzzustand der Tragfähigkeit im Bodenfüllkörper entstehende Gleitflächenschar und das hieraus entwickelte Nachweisverfahren nach Diskussion in den Fachgremien akzeptiert, kann die luftseitige Spundwand eines Fangedamms auf den aktiven Erddruck bemessen werden und muss nicht den nach EAU anzusetzenden 1,25-fachen aktiven Erddruck aufnehmen. Bei Ansatz eines dem inneren Gleitversagen entsprechenden Teil sicherheitsbeiwerts für den Bodenwiderstand ist die für eine ausreichende innere Standsicherheit des Bodenfüllkörpers erforderliche Breite des Kastenfangedamms nach dem vorgestellten Ansatz in der Regel kleiner als diejenige, die auf der Grundlage des Nachweises der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge gemäß EAU berechnet wird. x | |||||
| Wurzer, O.; Reiter, K.; Sodeikat, C. | Zur Instandsetzung aufgeschwommener Spannglieder an der Illerbrücke Thanners | Bautechnik | 11/2010 | 724-735 | Berichte |
KurzfassungAn der Unterseite des Überbaus West der Illerbrücke Thanners wurden nach dem Vorspannen von internen Spanngliedern und nach dem Verpressen der zugehörigen Hüllrohre ausgeprägte Längsrisse festgestellt. Durch umfangreiche Bauwerksuntersuchungen wurde als Schadensursache das Aufschwimmen von in der Bodenplatte des Überbaus angeordneten Spanngliedern bzw. Hüllrohren beim Betonieren des betroffenen Überbauabschnittes ermittelt. x | |||||
| Eggemann, H.; Kurrer, K.-E. | Zur internationalen Verbreitung des Systems Melan seit 1892: Konstruktion und Brückenbau | Beton- und Stahlbetonbau | 11/2006 | 911-922 | Berichte |
KurzfassungDas System Melan wurde im Jahre 1892 als Deckenkonstruktion patentiert, erste Versuche wurden 1893 vom “Ersten Österreichischen Gewölbeausschuß” durchgeführt. Besonderes Kennzeichen des Systems ist die Verbindung von stählernen Bogenrippen mit Betongewölben, also eine sogenannte steife Bewehrung. Heute wird das System Melan weltweit im Brückenbau eingesetzt. In diesem Aufsatz wird die internationale Verbreitung des Systems Melan von 1892 bis heute technikgeschichtlich dargestellt. Hauptverbreitungsgebiete waren zu Beginn Österreich, das Gebiet der heutigen Tschechischen Republik, die Schweiz, Italien und Deutschland; ferner Spanien, die Vereinigten Staaten von Amerika und auch Japan. Im Mittelpunkt des Interesses steht die gegenseitige positive Beeinflussung der regionalen Entwicklungen. Es lassen sich innovative Wechselwirkungen über große Distanzen bereits zu einem frühen Zeitpunkt dokumentieren. x | |||||
| Wöller, G. | Zur Iteration der Dreimomentengleichung. | Bautechnik | 1/1982 | 31-32 | |
| Zur Kanzerogenität von Glas- und Mineralwollfasern | Bauphysik | 1/1992 | 29-30 | Aktuelles | |
| Stirböck, K.; Valtinat, G. | Zur Kippsicherheit von Deckenträgern mit Kippaussteifungen. | Stahlbau | 2/1984 | 33-40 | Fachthemen |
KurzfassungUntersucht wird theoretisch und experimentell das Kippverhalten von langen Unterzügen, die durch belastete Querträger gehalten sind. Es werden Auswirkungen zur Wirksamkeit dieser Kippaussteifungen und ihrer Anschlüsse gemacht. Als Ergebnis wird mitgeteilt, daß durch derartige konstruktive Maßnahmen die Kipplängen der Unterzüge in vielen Fällen auf die Abstände der Queraussteifungen reduziert werden, und daß somit einfache Formeln und Tabellen zur schnellen Durchführung des Kippnachweises genutzt werden können. Ferner wird gezeigt, daß Gitterroste eine erheblich zusätzliche kippvermindernde Wirkung haben, ohne daß hier diese bei den Nachweisen rechnerisch berücksichtigt werden. Ausgeführte Traglastberechnungen zeigen, daß die gewählten Anschlußkonfigurationen weitgehend für die Traglast bestimmend sind und daß bereits durch die Wahl der Schraubengüte und durch Anordnung der Schrauben oder durch Vorspannen ein bestimmender Einfluß auf die Kipplast des Trägers erreicht wird. Versuche zeigen, daß die Berechnungsergebnisse auf der sicheren Seite liegen. x | |||||
| Oxfort, J. | Zur Kippstabilisierung stählerner I-Dachpfetten mit Imperfektionen in geneigten Dächern bis zum Erreichen der plastischen Grenzlast durch die Biege- und Schubsteifigkeit der Dacheindeckung. | Stahlbau | 12/1976 | 365-371 | Fachthemen |
| Oxfort, J. | Zur Kippstabilisierung stählerner I-Dachpfetten mit Imperfektionen in geneigten Dächern bis zum Erreichen der plastischen Grenzlast durch die Biege- und Schubsteifigkeit der Dacheindeckung. | Stahlbau | 10/1976 | 307-311 | Fachthemen |
| Mehlhorn, G.; Röder, F.-K.; Schulz, J.-U. | Zur Kippstabilität vorgespannter und nicht vorgespannter, parallelgurtiger Stahlbetonträger mit einfach symmetrischem Querschnitt. | Beton- und Stahlbetonbau | 2/1991 | 25-32, 59-64 | |
KurzfassungBei dem vorgestellten Näherungsverfahren wir der Nachweis der Kippstabilität eines gabelgelagerten Einfeldträgers mit Hilfe eines Bruchsicherheitsnachweises für zweiachsige Biegung in Trägermitte geführt. Mit den abgeleiteten Formeln können die benötigten Biegemomente mit einem sehr einfachen Verfahren näherungsweise ermittelt werden. x | |||||
| Protte, W. | Zur Knicksicherheitsberechnung bei tangententreuer Belastung. | Stahlbau | 10/1975 | 315-317 | Berichte |
| Lübke, Sebastian; Ungermann, Dieter | Zur Knittertragfähigkeit von Sandwichelementen unter lokaler Beanspruchung | Stahlbau | 11/2015 | 839-848 | Fachthemen |
KurzfassungDie Knittertragfähigkeit von Sandwichelementen am Zwischenauflager wird durch lokale Eindrückungen infolge senkrechter Druck- und Sogauflagerlasten reduziert. In diesem Artikel wird ein Verfahren zur Berechnung der Knittertragfähigkeit von Sandwichelementen unter lokaler Beanspruchung vorgestellt. Basierend auf umfangreichen Versuchsreihen und FE-Analysen wird das Knitterproblem analytisch auf ein nicht-lineares Spannungsproblem nach Theorie II. Ordnung zurückgeführt. Der traglastmindernde Einfluss der lokalen Beanspruchung wird dabei durch äquivalente geometrische Ersatzimperfektionen berücksichtigt, die für den Fall der punktuellen Lasteinleitung durch Schrauben (Sogverankerung) und linienförmigen Lasteinleitung (Druckauflager) vorgestellt werden. Abschließend wird auch die Möglichkeit eines schlankheitsabhängigen Nachweises mittels einer Knickspannungslinie vorgestellt. x | |||||
| Quast, U. | Zur Kombination von Einwirkungen nach Eurocode 2. | Beton- und Stahlbetonbau | 2/1996 | 25-29 | Fachthemen |
KurzfassungBei vektorieller Addition der Einwirkungen in einem N/M-Diagramm läßt sich die für die Bemessung eines Einzelbauteils maßgebende Kombination gezielt ermitteln. Die für den Hochbau zulässige Vereinfachung ist nicht einfacher zu handhaben. Im Sinne eindeutiger Regeln sollte sie auch deshalb entfallen, weil sie sowohl zu ungünstigeren als auch zu günstigeren Bemessungen führen kann. Computerprogramme sollten die besser zu verstehende grafische Form der Ergebnisdarstellung nutzen. Die Kombinationsregeln sind für die Weiterleitung der Beanspruchungen ungeeignet. x | |||||
| Graße, W. | Zur Kombination zeitveränderlicher Einwirkungen. | Stahlbau | 8/1995 | 230-238 | Fachthemen |
KurzfassungMit Methoden der Zuverlässigkeitstheorie wird eine neue Lastkombinationsregel begründet, die einfacher und wirtschaftlicher ist als die Regeln nach DIN 18800 Teil 1, DASt-Richtlinie 103 und ENV 1991-1. Danach ist die größte veränderliche Einwirkung (gemessen an der jeweiligen Beanspruchung) voll anzusetzen, die übrigen veränderlichen Einwirkungen dürfen in der Regel auf 50 % abgemindert werden. Das Kombinationsgesetz kann baustoffunabhängig in allen Bauweisen angewendet werden. Außerdem werden die Möglichkeiten und notwendige Forschungsarbeiten diskutiert, die Monte-Carlo-Simulation zur praktischen Behandlung von Lastkombinationsproblemen unmittelbar im Planungsbüro zu nutzen. x | |||||
| Protte, W. | Zur kombinierten Gurt-Stegblech-Beulung (Gesamtstabilität) versteifter I- und Kasten-Träger unter Biegemomenten-, Normalkraft- und Querkraftbeanspruchung. | Stahlbau | 9/1979 | 282-283 | Berichte |
| Protte, W. | Zur kombinierten Gurt-Stegblech-Beulung querbelasteter I-Träger mit einem breiten Gurt. | Stahlbau | 5/1983 | 151-153 | Berichte |
| Protte, W. | Zur kombinierten Gurt-Stegblech-Beulung querbelasteter Kastenträger mit breitem Obergurt. | Stahlbau | 2/1984 | 51-55 | Berichte |
| Protte, W. | Zur kombinierten Gurt-Stegblech-Beulung von Kastenträgern mit dreieckförmigem, geschlossenem Querschnitt. | Stahlbau | 9/1986 | 269-275 | Fachthemen |
KurzfassungEs wird ein Einfeldträger mit dreieckförmigem, symmetrischem Hohlquerschnitt hinsichtlich seines Beulverhaltens nach der linearen Beultheorie untersucht. Eine Obergurthälfte und ein Stegblech werden in eine Ebene geklappt und sodann geeignet in eine virtuelle Platte mit der Dicke Null eingebettet. Für Lastfälle "Querlasten längs der Kanten des Dreieckquerschnittes" werden zunächst durch eine Scheibenberechnung mit Hilfe der Airyschen Spannungsfunktion die Spannungen im Obergurt und in den Stegblechen berechnet, die dann der anschließenden Beulwertberechnung zu Grunde gelegt werden. Außerdem werden Beulwerte gerechnet für Lastfälle, bei denen die äußere Belastung an den Enden des Einfeldträgers angreift: Biegmomente und Normalkräfte, Biegemomente und Querkräfte, Torsionsmomente. x | |||||
| Schwartz, Joseph | Zur Kompetenz des Bauingenieurs im architektonischen Gestaltungsprozess | Stahlbau | 9/2014 | 668-670 | Berichte |
| Kurrer, K.-E. | Zur Komposition von Raumfachwerken von Föppl bis Mengeringhausen | Stahlbau | 8/2004 | 603-623 | Fachthemen |
Kurzfassung"Architektur ist gefrorene Musik". Trifft dieses einschlägig oft zitierte Wort des Philosophen Arthur Schopenhauer (1788-1860) auch für Bauwerke des Konstruktiven Ingenieurs zu, dann kann sein Tragwerksentwurf als strukturale Komposition begriffen werden. Dies wird im folgenden begrifflich präzisiert und am Beispiel der historischen Entwicklung der Raumfachwerke aufgezeigt. x | |||||