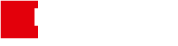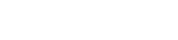| Scheidel, Sabine; Dienst, Sebastian; Kornadt, Oliver | Anwendungsmöglichkeiten der neuen "Muster-Holzbaurichtlinie" für Holzrahmenbauteile | Bauphysik | 1/2022 | 40-45 | Berichte |
In der Baubranche, wie auch in vielen anderen Bereichen, legen Politik und Gesellschaft immer stärkere Priorität auf ein nachhaltiges, ressourcenschonendes und ökologisches Denken und Handeln. Zur Errichtung und Erweiterung von Gebäuden ist Holz hier als besonders geeignet zu sehen, was auch die Charta für Holz verdeutlicht. Im Juni dieses Jahres wurde die neue Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauR) durch die Aufnahme in die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) eingeführt. Bereits vor der offiziellen Einführung wurde diese als ein weiterer Schritt in Richtung der bauaufsichtlich geregelten Holzgebäude bis zur Gebäudeklasse 5 gewertet. Die Richtlinie soll die Anwendung von Holz als Baustoff über eine Geschosshöhe von 13 m hinaus zulässig machen und auch eine Ausführung tragender und raumabschließender Bauteile mit einer feuerbeständigen Anforderung in Holzbauweise ermöglichen. Bei einem Vergleich der neuen MHolzBauR mit der bisher gültigen Muster-Richtlinie erkennt man jedoch keinen nennenswerten Unterschied zwischen den brandschutztechnischen Anforderungen an eine Holzrahmenkonstruktion. Damit können die lang ersehnten Möglichkeiten für Holzgebäude bis zur Hochhausgrenze nur in Massivholzbauweise realisiert werden. Ein nicht unerheblicher Bereich des Holzbaus bleibt weiterhin auf die Gebäudeklasse 4 begrenzt.
Possible applications of the new “Muster-Holzbaurichtlinie” for timber frame components
In the construction industry, politics and society are placing increasing priority on sustainable, resource-conserving and ecological thinking and action. Wood is a particularly suitable building material for this. In June this year, the new German Model Guideline on Fire Protection Requirements for Building Components and External Wall Cladding in German Timber Construction was officially introduced by inclusion in the Model Administrative Regulation on Technical Building Regulations. The guideline is not only to permit the use of wood as a building material from a total storey height of 13 m, but also to allow a construction method for wooden building components with a fire resistance duration of more than 90 minutes. However, there are no possibilities under the new directive to use timber frame components in buildings above a height of 13 m. This means that the long-desired possibilities to erect timber buildings above the high-rise limit can only be realised in solid timber construction. x |
| Bauphysik Aktuell 1/2022 | Bauphysik | 1/2022 | 46-53 | Bauphysik Aktuell |
Aktuell:
Forschungsprojekt über beregnete (Putz)Fassaden
Erneuerung des Saaneviadukts gewinnt den Ernst & Sohn Ingenieurbaupreis 2022
Barocke Propstei in Kruft beherbergt heute fünf barrierefreie Wohnungen
Building Simulation Conference 2025: Call for Proposals
BauSIM Konferenz 2022 in Weimar
Bauphysiktage Kaiserslautern 2022
x |
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 1/2022 | 54 | Veranstaltungen |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Titelbild: Bauphysik 6/2021 | Bauphysik | 6/2021 | | Titelbild |
Zum Titelbild:
Schüco AF UDC 80 Green Façade - Dichte Bebauung, versiegelte Flächen, wenig Natur und Abgase beeinträchtigen das Stadtklima negativ. Wie Pflanzen auch auf engem Raum in Großstädten ihren Platz finden, zeigt Schüco mit der begrünten Aluminium-Fassade AF UDC 80 Green Façade. Der Bielefelder Gebäudehüllenspezialist hat eine Objektlösung für die Schüco Elementfassade UDC 80 entwickelt, die durch zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, eine vielfältige Pflanzenauswahl und verschiedene Systembauarten die Stadt grüner werden lässt. Das Besondere: die Pflanzen wachsen in der Fassade und brauchen keinen Bodenanschluss. So können auf kleinstem Raum große Blattmassen am Gebäude realisiert werden für ein verbessertes Stadtklima und mehr Aufenthaltsqualität in den Großstädten. (Foto: Schüco)
x |
| Inhalt: Bauphysik 6/2021 | Bauphysik | 6/2021 | | Inhalt |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Rosen, Anja | Urban Mining Index - Planungs- und Bewertungsinstrument für zirkuläres Bauen | Bauphysik | 6/2021 | 357-365 | Aufsätze |
Mit dem Urban Mining Index wurde an der Bergischen Universität Wuppertal ein Planungsinstrument für zirkuläres Bauen entwickelt. Es ist die erste Systematik, die die Kreislauffähigkeit von Baukonstruktionen quantitativ messbar macht und dabei sowohl die Qualität der zirkulären Materialverwendung als auch den Rückbauaufwand und die Wirtschaftlichkeit des selektiven Rückbaus in die Bewertung einbezieht.
Zur systematischen Erfassung von Baukonstruktionen wurde eine Matrix in Form eines anwenderfreundlichen Exceltools entwickelt, mit der die Kreislaufpotenziale und der CO2-Footprint auf Bauteil- und Gebäudeebene berechnet und bewertet werden können. Über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks werden alle eingehenden Materialien und alle daraus entstehenden Wert- und Abfallstoffe berechnet und nach den Qualitätsstufen ihrer Nachnutzung bewertet. Der Anteil der zirkulären Baustoffe an der Gesamtmasse aller im Lebenszyklus des Bauwerks verbauten Materialien beziffert das Ergebnis, den Urban Mining Indicator.
An ersten Modellprojekten, wie dem Neubau für das Rathaus in Korbach, konnte mit dem “UMI” die Optimierung für das ressourcenschonende Bauen nachgewiesen werden.
Urban Mining Index - planning and assessment tool for circular construction
With the Urban Mining Index, a planning tool for circular construction has been developed at the University of Wuppertal. It is the first system that makes the circularity of building constructions quantitatively measurable and includes both the quality of circular material use as well as the deconstruction effort and the economic efficiency of selective deconstruction in the evaluation.
A matrix in the form of a user-friendly Excel tool was developed for the systematic recording of building constructions, with which the circularity potential and the CO2 footprint can be calculated and evaluated at component and building level. Over the entire life cycle of a building, all incoming materials and all resulting valuable and waste materials are calculated and evaluated according to the quality levels of their subsequent use. The proportion of circular building materials in the total mass of all materials used in the life cycle of the building quantifies the result: the Urban Mining Indicator.
In first model projects, such as the new building for the town hall in Korbach, the optimisation for resource-saving sustainable construction could be demonstrated with the “UMI”. x |
| Paulukat, Carolin; Pape, Eva-Maria | Energetische Kennzahlen von Theaterbauten im Bestand - Klassifizierung des Energieverbrauchs und Potenzial energetischer Sanierungen | Bauphysik | 6/2021 | 366-374 | Aufsätze |
Im Zuge der Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland ist der Energieverbrauch von Gebäuden stark in den Fokus gerückt. Der Energieverbrauch sowie die energetischen Einsparpotenziale von Gebäuden differieren in Abhängigkeit von der Gebäudetypologie. Verlässliche Aussagen diesbezüglich können nur durch die sukzessive Analyse der einzelnen Gebäudetypologien getroffen werden. Die komplexe Gebäudetypologie der Theaterspielstätten war bisher noch nicht Gegenstand der Forschung, sodass keine energetischen Kennwerte für den Gebäudebestand vorlagen. Mittels einer Querschnittserhebung wurde in Deutschland durch die Technische Hochschule Köln eine entsprechende Datenbasis geschaffen. Hierbei wurde festgestellt, dass der durchschnittliche Stromverbrauch des Gebäudebestands von Theaterspielstätten bei 60,5 kWh/(m2a) liegt. Der spezifische Verbrauch für Heizung und Warmwasser fällt mit 104,6 kWh/(m2a) höher aus. Die Gegenüberstellung mit normativen Referenzwerten hat gezeigt, dass der durchschnittliche Stromverbrauchskennwert der Stichproben diese um ein Vielfaches übersteigt, während der Verbrauchskennwert für Heizung und Warmwasser leicht darunter liegt. Einzelne Faktoren, die das Energieverbrauchsniveau maßgeblich beeinflussen, konnten auf Basis der Stichproben nicht eindeutig identifiziert werden.
Energy performance indicators of existing theatre buildings - classification of energy consumption and potential of energy-related refurbishment
In terms of climate goals, energy consumption of buildings has become a focus of attention. Energy consumption and energy saving potential of buildings differ depending on the building typology. The complex building typology of theatre buildings has not yet been subject of research, so no key energy values for the building stock were available. By means of a cross-sectional survey, a corresponding database was created. It was found that the average electricity consumption of theatre buildings is 60.5 kWh/(m2y). The specific consumption for heating and hot water is higher at 104.6 kWh/(m2y). The comparison with normative reference values has shown that the average electricity consumption value of the data collection exceeds these many times over, while the consumption value for heating and hot water is slightly lower. Individual factors that significantly influence the energy consumption level could not be clearly identified. x |
| Steinbach, Sven; Kunde, Christoph | Algorithmus zur Bewertung von extrapolierten Treibhausgasemissionen von Wohnungsunternehmen | Bauphysik | 6/2021 | 375-381 | Aufsätze |
Im Zuge sich verschärfender Zielstellungen zur Minderung der Treibhausgasemissionen sehen sich auch Wohnungsunternehmen in der gesellschaftlichen Pflicht, weitere Maßnahmen zur energetischen Optimierung ihrer Gebäudebestände umzusetzen. Ausgangspunkt der im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegten Minderungsziele ist das Bezugsjahr 1990. Für die Unternehmen der Wohnungswirtschaft besteht dadurch die Herausforderung, dass Energieverbrauchsdaten von 1990 bis dato vorhanden sein müssen, um den zeitlichen Verlauf der Treibhausgasemissionen abbilden zu können. Eine systematische Erfassung der Verbrauchsdaten von den meisten Wohnungsbeständen der Wohnungsgenossenschaften und -unternehmen begann jedoch erst im Laufe der 2000er Jahre. Eine fundierte Einschätzung im Kontext der Klimaschutzziele ist deshalb nur schwer möglich. Der entwickelte Algorithmus ermöglicht eine rückwärtige Beurteilung der Treibhausgasemissionen auf Basis statistischer Metadaten. Die bereits erfassten Verbräuche für die Erzeugung von Raumwärme und Trinkwarmwasser werden hierfür witterungs- sowie leerstandsbereinigt und hinsichtlich ihres Treibhauspotenzials bewertet. Auf Basis einer repräsentativen Datengrundlage können mithilfe des entwickelten Verfahrens dann die flächenspezifischen Treibhausgasemissionen zum Bezugsjahr extrapoliert werden. Der erhaltene Wertebereich kann sowohl als Dokumentation für die meist rückläufige Entwicklung der Emissionen der jeweiligen Wohnungsbestände als auch als Grundlage für zukünftige Modernisierungsentscheidungen dienen. Ein Abgleich des ermittelten Graphen mit den Investitionsausgaben des im Rahmen einer Studie untersuchten Unternehmens konnte die Anwendbarkeit der Vorgehensweise bestätigen.
Algorithm for assessment of greenhouse gas emissions of housing companies with extrapolated dates
While goals for the reduction of greenhouse gas emissions are increasing, housing companies also see themselves under a social obligation to implement further measures for the energy optimization of their buildings. The starting point for the reduction goals set out in the German Federal Climate Change Act is the reference year 1990. For the companies, this poses the challenge that systematic recording of their consumption data only began during the 2000s. A well-founded assessment in the context of the climate protection goals is therefore difficult to make. The developed algorithm enables a backward assessment of greenhouse gas emissions based on statistical metadata. For this purpose, the already recorded consumptions for the generation of heating and hot water are adjusted (interannual weathers and vacancy rate) and evaluated with regard to their greenhouse potential. Based on a representative data basis, the area-specific greenhouse gas emissions can extrapolate to the reference year by the help of the developed method. The obtained range of values can for example serve as basis for future modernization decisions. A comparison of the determined graph with the investment expenditures of the company under consideration was able to confirm the applicability of the procedure. x |
| dena-Leitstudie "Aufbruch Klimaneutralität" mit FIW-Beteiligung | Bauphysik | 6/2021 | 381 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Chriti, Manuela; Mitterböck, Michael; Korjenic, Azra | Bauphysikalische Untersuchungen von mit Leinölfirnis stabilisierten und beschichteten Lehmputzen | Bauphysik | 6/2021 | 382-388 | Aufsätze |
Aufgrund zahlreicher Vorurteile gegenüber traditionellen Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere aber aufgrund von Unkenntnis der Festigkeitseigenschaften und der bauphysikalischen und hygrothermischen Eigenschaften, stellt der Einsatz solcher Baumaterialien im Hochbau nach wie vor eine Randerscheinung dar. Dazu zählt auch die Anwendung von Lehmputz im Außenbereich. In zwei Forschungsvorhaben wurde zum einen die Wirkung von Leinölfirnis als Additiv in Lehmmörtel im Rahmen von Laboruntersuchungen analysiert. Laborproben mit einem Anteil von 1 % Leinölfirnis bezogen auf die Lehm-Trockenmasse wiesen erhöhte Festigkeitswerte sowie Sorptionsfähigkeit auf, wohingegen sich der Wasserdampfdiffusionswiderstand dieser Proben nur geringfügig erhöhte. Zum anderen wurde ein In-Situ-Monitoring eines ökologisch nachhaltigen Wandaufbaus mit Lehmputz und Beschichtung aus Leinölfirnis über mehrere Jahre durchgeführt und bewertet. Die geforderte Funktionstüchtigkeit und Dauerhaftigkeit wurden durch den untersuchten Lehm-Außenputz mit Leinölfirnis-Anstrich erfüllt.
Building physical investigations of clay plasters stabilized and coated with linseed oil varnish
Due to numerous prejudices against traditional building materials made from renewable raw materials, but in particular due to ignorance of the physical, structural and hygrothermal properties, the use of such building materials in building construction is still rare. This also includes the use of clay plaster outdoors. In two current research projects, the effect of linseed oil varnish used as a mortar additive was analyzed in laboratory tests. Laboratory samples with a proportion of 1 % linseed oil varnish in a percentage of the dry clay mass showed increased strength values and sorption capacity, whereas the water vapor diffusion resistance of these samples increased only slightly. An in-situ monitoring of an ecologically sustainable wall construction with clay plaster and coating of linseed oil varnish was carried out over several years and evaluated. The required functionality and durability of the investigated clay exterior plaster were achieved through the use of linseed oil varnish coating. x |
| Pichlhöfer, Alexander; Streit, Erich; Rosenberg, Egon Erwin; Korjenic, Azra | Einfluss einer Luftaufbereitungsanlage auf flüchtige organische Verbindungen unter Realbedingungen | Bauphysik | 6/2021 | 389-399 | Aufsätze |
Aufgrund des steigenden Bewusstseins für Luftqualität und Gesundheit, auch beeinflusst durch die Corona-Krise, werden generell vermehrt Luftreinigungs-Maßnahmen umgesetzt. Ozonierungs- und Ionisationsanlagen werden aktuell stark nachgefragt. Um die Qualität der durch die Benützung von Luftreinigungsanlagen aufbereiteten Luft zu untersuchen, wurden im Rahmen der gegenständlichen Untersuchungen Luftanalysen durchgeführt. Es wurde geprüft, ob durch den Betrieb dieser Anlagen unerwünschte, gesundheitlich bedenkliche chemische Verbindungen entstehen. Insbesondere wurde der Frage nachgegangen, ob durch den Betrieb der Luftaufbereitungsanlage, welche die in der Luft enthaltenen VOCs (volatile organic compounds, flüchtige organische Verbindungen) idealerweise vollständig zu Kohlenstoffdioxid und Wasser umsetzt, zusätzliche entstandene Luftschadstoffe nachgewiesen werden können. Aus der aufbereiteten Luft eines Seminarraums eines Wiener Spitals wurden Luftproben entnommen. Der Luftstrom wird durch eine Luftaufbereitungsanlage bestehend aus einem Ozonierungsmodul, zwei Ionisationsmodulen sowie einem Luftfilter geführt. Die Probennahme der vor Ort gesammelten Luft erfolgte im Labor mittels SPME (solid phase microextraction, Festphasen-Mikroextraktion). Die an der Außenluft referenzierte, semi-quantitative Analyse erfolgte mittels Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion (GC-MS). Bei allen Messungen wurden aliphatische Kohlenwasserstoffe in unbedenklichen Konzentrationen gefunden. Durch den Betrieb der Luftaufbereitungsanlage wurden keine signifikant erhöhten Konzentrationen von gesundheitsschädlichen VOCs nachgewiesen.
Influence of an air treatment module on volatile organic compounds under real conditions
Due to the increasing awareness of air quality and health, also influenced by the Corona crisis, more and more air cleaning devices are being installed. Ozonation and ionization systems are currently in high demand. It is unclear whether the operation of these systems creates undesirable, health-hazardous, volatile chemical compounds. The examinations described in this article were carried out in a seminar room of a Viennese hospital. The air is being led through one ozonation and two ionization modules as well as an air filter. The intention of the investigations was to assess whether additional air pollutants, produced by the operation of the air treatment system could be detected. The installed devices are ideally supposed to completely convert the VOCs (volatile organic compounds) in the air into carbon dioxide and water. The air collected on site was sampled in the laboratory using SPME (solid phase microextraction). The semi-quantitative analysis referenced to the outside air was carried out by means of gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS). In all measurements, aliphatic hydrocarbons were found in harmless concentrations. No significantly increased concentrations of harmful VOCs was detected as a result of the operation of the air treatment system. x |
| Förderpreise für Schallschutz mittels Gabionenwand und für Optimierung von Schwingungsdämpfern | Bauphysik | 6/2021 | 399 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Neubauer, Reinhard O. | Die Klassifizierung des Schallschutzes DnT,w mithilfe des Schalldämm-Maßes R'w | Bauphysik | 6/2021 | 400-410 | Aufsätze |
Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz gewährleisten. Dieser Schallschutz wird bauordnungsrechtlich geregelt. In Deutschland regelt dies DIN 4109 Teil 1 mit Angabe eines “Mindestschallschutzes”. Darüberhinausgehende Anforderungen werden als “erhöhter Schallschutz” bezeichnet. Eine erhöhte Schalldämmung führt jedoch nicht zwingend zu einem erhöhten Schallschutz. Schallschutz und Schalldämmung sind diesbezüglich nicht gleichzusetzende Begriffe. Der Schallschutz kann durch eine Klassifikation als Bewertungsmaßstab für die Qualität einer Wohnung charakterisiert werden. Verschiedene europäische Länder haben Klassifizierungssysteme eingeführt, zum Teil als Kenngrößen des Schallschutzes (z. B. DnT,w) und zum Teil als Kenngrößen der Schalldämmung (z. B. R'w). In diesem Artikel wird gezeigt, dass eine direkte Zuordnung der Größen R'w und DnT,w nur für bestimmte geometrische Verhältnisse von Raumvolumen und Trennbauteilfläche (V/S) möglich ist. Wird eine zulässige Abweichung zwischen R'w und DnT,w akzeptiert, kann eine Klassierung der Schalldämmwerte (R'w) mit festen Klassengrenzen vorgenommen werden. Damit wird eine Klassifizierung des Schallschutzes mit Bezug auf die beschreibende Kenngrößen DnT,w mithilfe der Größe Bau-Schalldämm-Maß R'w möglich. Die Klassifizierung des Schallschutzes unter Verwendung des bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes R'w bleibt jedoch eine Funktion des geometrischen Verhältnisses von Raumvolumen (V) zu Trennbauteilfläche (S).
The classification of soundproofing with the measure DnT,w with use of the weighted apparent sound reduction index R'w
Buildings must ensure sound insulation appropriate to their use. This sound insulation is regulated by building regulations. In Germany, this is regulated by DIN 4109 Part 1 with a specification of a “minimum sound insulation”. Additional requirements are referred to as “increased sound insulation”. However, increased sound insulation does not necessarily lead to increased soundproofing. Soundproofing and sound insulation are not equivalent terms in this respect. This article shows that a direct assignment of the quantities R'w and DnT,w is only possible for certain geometric ratios of room volume and separating area (V/S). If a permissible deviation between R'w and DnT,w is accepted, a classification of the sound insulation values (R'w) with fixed class limits can be made. This makes it possible to classify the sound insulation with reference to the descriptive parameter DnT,w using the weighted apparent sound reduction index R'w. x |
| Erstmals 20 % Wasserstoff im deutschen Gasnetz mit Avacon und DVGW | Bauphysik | 6/2021 | 410 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Bauphysik Aktuell 6/2021 | Bauphysik | 6/2021 | 411-423 | Bauphysik Aktuell |
Persönliches:
Ein persönlicher Nachruf auf Jörg Schlaich
Aktuell:
Bundesstiftung Bauakademie - Gründungsdirektor Guido Spars
30 Jahre Passivhaus und Passive House Award 2021
Neue Wege für nachhaltige Architektur mit dem livMatS-Pavillon
Merkblatt Luftdichtigkeit von Öffnungen zur Rauchableitung in Aufzugsschächten
Energetische Gebäudeförderung mit Rekordzahlen
Hinweise zur TR Instandhaltung und Normenkontrollverfahren
Bundesingenieurkammer fordert eigenständiges Bundesbauministerium
DGNB veröffentlicht Studie zu CO2-Emissionen von Bauwerken
BauSIM Konferenz 2022 in Weimar
Bauphysiktage Kaiserslautern 2022
Bücher:
Addis, Bill (Ed.): Physical Models
Holzer, Stefan M.: Gerüste und Hilfskonstruktionen im historischen Baubetrieb x |
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bauphysik | 6/2021 | 423-424 | Veranstaltungen |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Inhalt: Bauphysik 5/2021 | Bauphysik | 5/2021 | | Inhalt |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Titelbild: Bauphysik 5/2021 | Bauphysik | 5/2021 | | Titelbild |
Zum Titelbild:
Ein Flachdach effektiv und zeitsparend sanieren - mit KFW-Zuschuss zum zukunftssicheren Umkehrdach: Ein reizvolles Architektenhaus in Bielefeld aus dem Jahr 1965 hatte Bedarf in Sachen Wärmeschutz. Dabei stand der komplette Ersatz für ein Kaltdach in Holzbalkenkonstruktion durch ein Umkehrdach an. Den besonderen Schwerpunkt legten die neuen Besitzer hier auf eine effiziente Wärmedämmung des Flachdachs: JACKODUR® KF 300 aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) und JACKODUR® Dachvlies WA kamen hier zum Einsatz und machten aus einem in die Jahre gekommenen Kaltdach ein zukunftssicheres Umkehrdach. (Foto: JACKODUR)
x |
| Fahrion, Marc-Steffen; Nickl, Christoph; Bangalore, Deekshitha; Lakatos, Michael; Brombacher, Moritz | Sommerlicher Wärmeschutz durch die Begrünung von Außenanlagen und Gebäuden | Bauphysik | 5/2021 | 291-302 | Aufsätze |
Infolge des Klimawandels werden die Sommer in Deutschland im Durchschnitt immer heißer. Die Begrünung von Außenanlagen und Gebäuden reduziert den städtischen Wärmeinseleffekt und verbessert das Mikroklima. Ob sich dies auch bei stark gedämmten Gebäuden wesentlich auf den sommerlichen Wärmeschutz und die Behaglichkeit in Innenräumen auswirkt, ist bislang allerdings unklar. Um diese Fragestellung zu untersuchen, wurden thermisch-dynamische Gebäudesimulationen mit IDA ICE und Mikroklimasimulationen mit ENVI-MET gekoppelt. Die Untersuchung erfolgte an einer für Deutschland typischen Ein- und Mehrfamilienhaussiedlung. Im Vergleich zu unbegrünten Gebäuden und Gartenflächen mit Rasen kann durch das Pflanzen von Sträuchern und Bäumen in Kombination mit einer extensiven Dachbegrünung und Moosfassaden der sommerliche Wärmeschutz an einem heißen Tag um bis zu 20 % verbessert werden. Die Begrünung hat gegenüber konventionellen Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz den Vorteil, dass bei gezielter Pflanzenauswahl zusätzlich die Biodiversität und die Luftqualität am Standort verbessert werden.
Protection against summer overheating due to greening in the built environment
Due to climate change, the average summer climate in Germany gets hotter. The greening of outdoor facilities and buildings reduces the urban heat island effect and improves the micro-climate. If this has a significant effect on the protection against summer overheating and the indoor thermal comfort of highly insulated buildings, is so far unknown. This question is investigated by coupling the thermal-dynamic building simulation software IDA ICE with the micro-climate simulation software ENVI-MET. The investigation was carried out using a typical residential area in Germany. In comparison to conventional buildings and gardens with only lawn, the planting of shrubs and trees in combination with extensive roof greening and moss façades enhances the protection against summer overheating on a hot day by up to 20 %. Through an appropriate plant selection the greening leads to an enhanced biodiversity and a better air quality, which is not possible, using conventional measures for the protection against summer overheating. x |
| Fassadenbegrünung des Jahres 2020 an einer Häuserwand in Wien | Bauphysik | 5/2021 | 302 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Sudhoff, Patrick; Steeger, Felix; Zehfuß, Jochen; Kampmeier, Björn | Brandverhalten von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen - Teil 2: Untersuchungen zur bautechnischen Verwendung im Gefach von Holztafelbauweisen | Bauphysik | 5/2021 | 303-313 | Aufsätze |
In Teil 1 dieser Aufsatzserie zum Forschungsvorhaben “Mehr als nur Dämmung - Zusatznutzen von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (nawaRo-Dämmstoffe)” wurden die experimentellen Untersuchungen zum Auslösen, Verlauf und Löschverhalten von Schwelprozessen in nawaRo-Dämmstoffen, der Wirkung von Flammschutzmitteln und denen im Zersetzungsprozess freigesetzten Emissionen dargestellt. Im vorliegenden Beitrag werden die Untersuchungen zur bautechnischen Verwendung von nawaRo-Dämmstoffen, anstelle einer nichtbrennbaren Dämmung, im Gefach von Holztafelbauweisen dargestellt. Zunächst werden die Ergebnisse eines Großbrandversuchs zum Naturbrandverhalten von Holztafelbauteilen mit nawaRo-Dämmstoffen präsentiert. Anschließend wird die Entwicklung analytischer und numerischer Modelle für den Nachweis der raumabschließenden Funktion veranschaulicht. Den Abschluss des Beitrags bildet ein Ausblick auf das Forschungsprojekt “PyroProBiD”, in welchem erweiterte Transport- und Reaktionsmodelle entwickelt werden.
Fire performance of insulating materials made from renewable resources - Part 2: Investigations on the use as compartment filling in timber panel constructions
In the previous article on the research project “more than just insulation - additional benefits of insulating materials made from renewable resources”, the experimental investigations on the initiation, process and extinguishing behavior of smoldering processes, the effect of flame retardants and the emissions released in the combustion process were presented. In this paper, the investigations on the structural use of renewable insulation materials, instead of the previously required non-combustible insulation, is presented in the context of wood panel construction. First, the final large-scale fire test on the natural fire behavior of wood panel building components with renewable insulation materials is presented. Then, the development of analytical and numerical models for the separating function is illustrated. The paper concludes with an outlook on the research project “PyroProBiD”, in which advanced transport and reaction models are being developed. x |
| Voss, Karsten; Nengel, Nils; Berges, Malin Johanna; K?rant-Miti , Tu çin | Dezentrales Monitoring als Beitrag zur Verbesserung des Raumklimas und der Betriebsführung von Nichtwohngebäuden | Bauphysik | 5/2021 | 314-325 | Aufsätze |
Viele bestehende Nichtwohngebäude bieten Potenziale zur Verbesserung des Raumklimas und der Energieperformance durch eine verbesserte Nutzung und Betriebsführung. Dazu müssen aber zunächst die Verhältnisse messtechnisch erfasst und beurteilt werden, sodass Handlungsempfehlungen entwickelt werden können. Bestehende Gebäudeautomationssysteme sind dazu häufig nicht ausreichend qualifiziert. Eine entsprechende Erweiterung der Hard- und/oder Software ist oft wirtschaftlich unverhältnismäßig. Vor diesem Hintergrund wurden in exemplarischen Gebäuden raumklimatische Messungen mit dezentralen Datenloggern unterschiedlicher Bauart über mindestens ein Jahr durchgeführt. Die drei für diesen Beitrag ausgewählten Gebäude besitzen sehr unterschiedliche Lüftungskonzepte. Die beiden Gebäude ohne raumlufttechnische (RLT) Anlagen zeigten auf unterschiedliche Weise den Einfluss des Nutzerverhaltens auf das erreichte raumklimatische Niveau. Das Gebäude mit RLT-Anlage zeigte beispielhaft den Einfluss einer unvorteilhaften Sollwertsetzung auf den Energieverbrauch. Die dezentrale Messtechnik bietet große Potenziale für Qualitätssicherung im Bestand. Bei neuen Gebäuden besteht die Notwendigkeit, Gebäudeautomationssysteme bereits für die Aufgaben der Qualitätssicherung auszulegen und nicht nur auf Funktionssicherung zu setzen.
Decentral monitoring as a contribution towards improving indoor comfort and operation of commercial buildings
Many existing non-residential buildings offer potential for improving the indoor climate and energy performance through improved use and operational management. To do this, however, the conditions must first be measured and assessed so that recommendations for action can be developed. Existing building automation systems are often not sufficiently qualified for these activities. A corresponding expansion of the hardware and/or software is often economically disproportionate. Against this background, room climate measurements were carried out in exemplary buildings with decentralised data loggers of different designs over at least one year. The three buildings selected for this paper have very different ventilation concepts. The two buildings without air conditioning systems showed the influence of user behaviour on the achieved indoor climate level in different ways. The building with an air-handling system exemplified the influence of an unfavourable set point on energy consumption. Decentralised measurement technology offers great potential for quality assurance in existing buildings. In new buildings, it is necessary to design building automation systems for quality assurance tasks and not only for function assurance. x |
| Neues DBV-Merkblatt "BIM-Prozessqualität" mit Handlungsempfehlungen für die Hochbauplanung mit BIM | Bauphysik | 5/2021 | 325 | Aktuell |
Keine Kurzfassung verfügbar. x |
| Neubauer, Reinhard O. | Trittschalldämmung - Norm-Trittschallpegel L'n und Standard-Trittschallpegel L'nT im Vergleich | Bauphysik | 5/2021 | 326-334 | Aufsätze |
In DIN 4109 wird die Trittschalldämmung, ausgedrückt mit der kennzeichnenden Größe bewerteter Norm-Trittschallpegel L'n, w, zur Beschreibung des Trittschallschutzes verwendet. Eine für die Zwecke der Beschreibung des Trittschallschutzes brauchbarere Kenngröße stellt der bewertete Standard-Trittschallpegel L'nT, w dar. Durch analytischen Vergleich beider Kenngrößen wird gezeigt, welche Randbedingungen zur Anwendung der Gleichungen eingehalten werden müssen. Die Unterschiede aus dem Vergleich von Messergebnissen werden anhand eines Messdatensatzes von 69 durchgeführten Trittschallmessungen an Trenndecken unterschiedlichster Bauart dargestellt. Die Auswertung der Messergebnisse hat gezeigt, dass sich erhebliche Unterschiede für die gleiche Konstruktion und für den gleichen Empfangsraum ergeben können. Auch hat sich herausgestellt, dass eine vereinfachte Umrechnung beider Kenngrößen aus den Einzahlwerten Fehler von ±2 dB zur Folge haben können. Soll eine Beschränkung des “Fehlers” erfolgen, muss der betrachtete Raum begrenzt werden. Für eine tolerierte Abweichung von ±2 dB beschränkt sich die betrachtete Grundfläche in Abhängigkeit der Raumhöhe von 2,20 m - 4,0 m auf unter 22,5 m2. Werden größere Räume betrachtet, können erheblich größere Abweichungen auftreten.
Impact sound insulation - Normalized impact sound pressure level L'n and standardized impact sound pressure level L'nT in comparison
In DIN 4109, the impact sound insulation, expressed with the characteristic quantity of the weighted standard impact sound level L'n, w, is used to describe the impact sound protection. A, for the purpose of the description of the impact sound protection more useful characteristic variable, represents the weighted standard impact sound level L'nT, w. By analytical comparison of both parameters, it is shown which boundary conditions must be observed for the application of the equations. The differences from the equation of measurement results are shown on the basis of a measurement data set of 69 impact sound measurements carried out on ceilings of different types. The evaluation of the measurement results has shown that there can be considerable differences for the same design and for the same receiving room. It has also been shown that a simplified conversion of both parameters from the single values can cause errors of ±2 dB. If a limitation of the “error” is to take place, the surface of the floor considered must be limited. For a tolerated deviation of ±2 dB, the considered surface area is limited to less than 22.5 m2 depending on the room height from 2.20 m - 4.0 m. If larger rooms are considered, significantly larger deviations can occur. x |
| Mendgen, Anna; Schlaich, Mike | Infraleichtbeton für den Geschosswohnungsbau - Zusammenfassung und Vergleich des Forschungsstands zu GWP und thermischen Speichereffekten | Bauphysik | 5/2021 | 335-346 | Berichte |
Infraleichtbeton wird seit mehr als 15 Jahren am Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren - Massivbau der TU Berlin erforscht. Im Gegensatz zu anderen Dämmbetonen kann man mit Infraleichtbeton, aufgrund seiner Festigkeit, auch mehrgeschossige Gebäude errichten.
Die Kritik am Werkstoff Beton wegen des hohen CO2-Ausstoßes bei der Herstellung von Zement ist aktuell. Infraleichtbeton hingegen unterscheidet sich in vielen grundlegenden Eigenschaften von Normalbeton. In diesem Beitrag werden zunächst die spezifischen Unterschiede im Vergleich zu Normalbeton aufgezeigt. Es folgt die Erörterung des Verbrauchs und der Verfügung von Ressourcen im Vergleich zu Holzbau und zu Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), anschließend werden verschiedene Forschungsergebnisse zur Ökobilanz in Bezug auf das Treibhauspotenzial verglichen. Darauf aufbauend wird der bei der Berechnung von Ökobilanzen vernachlässigte Einfluss der Speichermasse auf Kühl- und Heizenergiebedarf genauer betrachtet. Abschließend wird eine erste Einordnung in Bezug auf den Einfluss des Treibhauspotenzials des Werkstoffs Infraleichtbeton im Vergleich mit anderen Werkstoffen bzw. Bauweisen vorgenommen.
Infra-Lightweight Concrete (ILC) for multi-storey housing - Summary and comparison of the current state of research in terms of GWP and thermal storage effects
Infra-lightweight concrete has been an object for research at the chair of conceptual and structural design at the Technical University of Berlin for 15 years. Due to its strength, in contrast to other thermal insulating concretes it is possible to build multi-storey buildings with infra-lightweight concrete. The global warming potential of concrete during production, is more alarming than ever. Infra-lightweight concrete, however, has significantly different properties compared to normal concrete. In this article those differences are explained. The consumption of various building materials and their availability are compared. Further several studies concerning the life cycle assessment of multi-storey housings are discussed. Based on these studies, the often-neglected influence of thermal storage effects is introduced.
Finally, all discussed factors that have a specific effect on the global warming potential of infra-lightweight concrete are summarized in order to be able to make a first classification of infra-lightweight concrete compared with other building materials. x |