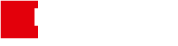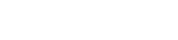Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedl, Caroline; Wernhart, Susanna; Scheidl, Christian; Proske, Dirk | Mureneinwirkungen auf Massivbrückenüberbauten | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 649-661 | Aufsätze |
KurzfassungBrückenbauwerke im alpinen Raum unterliegen verschiedenen Naturgefahren. Dazu zählen auch Muren. Murenereignisse führen nachweisbar auch zur Zerstörung von Brücken. Um Brücken für solche Einwirkungen zu bemessen, sind Angaben zur Anprallkraft von Muren notwendig. Für Murenanpralle gegen Pfeiler liegen umfangreiche, sowohl miniaturisierte als auch Realgrößenversuche vor. Für Brückenüberbauten sind bisher keine solchen Versuche bekannt. In diesem Beitrag werden miniaturisierte Murenanprallversuche an Massivbrückenquerschnitten vorgestellt. Basierend auf den Versuchsergebnissen werden Empfehlungen für die Bemessung von Massivbrücken in exponierten Lagen gegeben. x | |||||
| Rettinger, Martin; Lounis, Ali; Hückler, Alex; Schlaich, Mike | Druckversuche zur Ermittlung der Tragfähigkeit von ebenen und feinverzahnten Trockenfugen für modulare Segmentbrücken | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 662-675 | Aufsätze |
KurzfassungDie modularisierte und automatisierte Serienfertigung von Betonfertigteilen verspricht enorme Produktivitätssteigerungen in der Betonfertigteilindustrie bei gleichzeitig höherer Bauteilqualität, effizienterem Rohstoffeinsatz und verringerten Prozessabfällen. So werden durch die Modernisierung eines bisher überwiegend handwerklich geprägten Industriezweigs sowohl Ressourcen und Emissionen eingespart, als auch neue Wachstums- und Wertschöpfungsmöglichkeiten in Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels erschlossen. Modulares Bauen erfordert dabei die Erforschung und Entwicklung von neuartigen Prozessen, Bauweisen und Baumaterialien, welche die serielle und automatisierte Herstellung von Betonfertigteilen in effizienter Weise ermöglichen. Passgenau hergestellte Betonfertigteilmodule können ohne übergreifende Längsbewehrung und mit trockenen, ohne Kleber ausgeführten Fugen schnell und flexibel zu z. B. Segmentbrücken gefügt werden. Am Ende ihrer Nutzungszeit können sie zerstörungsfrei zurückgebaut und idealerweise in einem zweiten Lebenszyklus wiederverwendet werden. In einer Versuchsreihe haben die Autoren die Tragfähigkeit von glatten und feinverzahnten Trockenfugen untersucht, welche sich für das Fügen von modularen Segmentbrücken aus Carbonbeton eignen. In dem vorliegenden Beitrag werden die durchgeführten Versuche, die beobachteten Versagensmechanismen und quantitativen Versuchsergebnisse sowie der Vergleich mit international verfügbaren Bemessungsregeln diskutiert. x | |||||
| Mosig, Oliver; Beckmann, Birgit; Curbach, Manfred; Marx, Steffen | Einfluss des Wassergehalts auf die Druckfestigkeit von Beton unter hohen Dehnraten | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 676-684 | Aufsätze |
KurzfassungIn dieser Studie wurde der Einfluss verschiedener Lagerungsbedingungen auf die statische und dynamische Druckfestigkeit von drei Betonen (C20/25, C35/45 und C60/75) untersucht. Dabei wurden die Proben gezielt getrocknet und wassergesättigt und anschließend sowohl statisch als auch dynamisch geprüft. Die dynamischen Versuche wurden in einem Split-Hopkinson-Bar durchgeführt. Hierbei konnten je nach Betonfestigkeitsklasse Festigkeitssteigerungen von 200 bis 300 % bei Dehnraten im Bereich von 90 bis 160 1/s festgestellt werden. Im Vergleich zur Lagerung unter Umgebungsbedingungen sinkt die Druckfestigkeit durch die Trocknung aufgrund der Mikrorissbildung. Des Weiteren sinken die statischen und dynamischen Betondruckfestigkeiten von wassergesättigten Proben im Vergleich zu trockenen Proben. Dieser Abfall konnte sowohl unter statischer als auch unter dynamischer Beanspruchung beobachtet werden und ist unabhängig von der Dehnrate. Die trockenen Proben versagen explosionsartiger mit einer erhöhten Anzahl an Rissen und Bruchstücken im Vergleich zu wassergesättigten Proben. Weiterhin konnte am Beispiel zweier Fallturmversuche von einem trocken und einem wassergelagerten großformatigen Betonbauteil gezeigt werden, dass vorhandenes Porenwasser einen signifikanten Einfluss auf das Versagensbild und die Übertragung der Impaktbelastung in die Auflagerkonstruktion hat. x | |||||
| Zohrabyan, Vahan; Zöller, Raphael; Gradic, Simon; Braml, Thomas | Potenzial von 3D-gedruckten Stahlfaserbetonbauteilen zum Schutz kritischer Infrastruktur - Beschuss- und Freifallversuche | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 685-696 | Aufsätze |
KurzfassungDer Einsatz innovativer Fertigungstechnologien in der Baubranche unterstützt die Realisierung vollständig automatisierter Herstellungsverfahren mit dem Ziel, die Ausführungszeit, die Individualität und die Qualität von Bauteilen zu verbessern. Die Herstellung von Stahlfaserbetonbauteilen im selektiven Zementaktivierungsverfahren, welches das dreidimensionale Drucken von formoptimierten Bauteilen ermöglicht, kann die genannten Ziele erreichen. Um diese hinsichtlich ihres Verhaltens unter hochdynamischen Einwirkungen zu untersuchen, wurden insgesamt zehn Stahlfaserbetonprobekörper in unterschiedlichen Bauweisen gedruckt und durch Beschuss- und Freifallversuche mit hochdynamischen Belastungen beansprucht. Solche Belastungen führen zu komplexen inneren Beanspruchungen und entsprechenden Schadensbildern. Eine Darstellung von weiterhin bestehenden Schäden nach dem Impakt, insbesondere die korrekte Ausrichtung der Stahlfasern im Bauteil, zeigen Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten zukünftiger Schutzbauteile auf, welche nach aktuellem Stand der Technik noch nicht hinreichend erforscht sind. x | |||||
| Sagmeister, Bernhard; Reichel, Michael; Huß, Michael; Mayer, Michael | UHFB-Overlay auf Fuß- und Radwegbrücke Karl-Heine-Bogen in Leipzig | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 697-704 | Berichte |
KurzfassungBei einer Fuß- und Radwegbrücke über den Karl-Heine-Kanal in Leipzig wurden im Rahmen einer Bauwerksprüfung Undichtigkeiten in der Abdichtungsschicht aus reaktionsharzgebundenem Dünnschichtbelag (RHD) festgestellt. Darüber hinaus waren kleinere Betonschäden in Form von Abplatzungen vorhanden. Um eine langfristige Dauerhaftigkeit zu gewährleisten, wurden die Betonschäden beseitigt und die alte Abdichtung durch eine ultrahochfeste Faserbetonschicht, kurz UHFB-Deckschicht, von 30 mm Stärke ersetzt. Die neue Deckschicht hat nur eine Abdichtungsfunktion, die damit einhergehende Tragfähigkeitssteigerung wurde bei den Überlegungen nicht berücksichtigt. Wegen des möglichen Pannenrisikos für Fahrradreifen wurden anstelle von starren Stahlfasern biegsame PVA-Kunststofffasern verwendet. Auf ca. 160 m2 Fläche wurden innerhalb eines Tages insgesamt 6, 5 m3 faserverstärkter UHFB händisch verbaut. x | |||||
| Lorenz, Enrico; Peter, Alexander; May, Sebastian; Bösche, Thomas | Planung und Neubau einer Straßenbrücke aus Carbonbeton - Carbonbeton "The Next Step" | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 705-712 | Berichte |
KurzfassungIn der ostsächsischen Ortschaft Wurschen (Landkreis Bautzen) wurde im Jahr 2021 Sachsens erste Straßenbrücke aus Carbonbeton errichtet. Durch den Einsatz der neuartigen Carbonbetonbauweise sollen der Erhaltungsaufwand sowie die Wartungszyklen für Brückenbauwerke verringert und die Nutzungsdauer gegenüber dem heutigen Brückenbestand aus Stahlbeton deutlich gesteigert werden. Die hochzugfesten und unter den nutzbaren Spannungsbereichen nahezu ermüdungsresistenten Carbonbewehrungen sind hierbei aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Bewehrungskorrosion für den Einsatz im Bereich des Brückenbaus prädestiniert. Die Planung des Bauwerks wurde unter Beachtung der im Rahmen der langjährigen Forschungen der Institute für Massivbau der Technischen Universität Dresden und der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule Aachen ermittelten Bemessungs- und Konstruktionsgrundlagen durchgeführt. Die bauliche Umsetzung der Baumaßnahme erfolgte in Ortbetonbauweise unter Verwendung von Carbonflächenbewehrungen (Carbongittern), Carbonstabbewehrungen und üblichen Konstruktionsbetonen. Im Anschluss an die erfolgreiche Fertigstellung des Bauwerks konnte die Tragfähigkeit der Straßenbrücke aus Carbonbeton durch Belastungsversuche mit einem umfangreichen Messprogramm bestätigt werden. Die planmäßige Verkehrsfreigabe des Bauwerks erfolgte im Dezember 2021. x | |||||
| Beton- und Stahlbetonbau aktuell 9/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 713 | Beton- und Stahlbetonbau aktuell | |
Kurzfassung
x | |||||
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Beton- und Stahlbetonbau | 9/2023 | 714 | Veranstaltungskalender | |
| Ernst & Sohn (Hrsg.) | UBB 9/2023 - Gesamtausgabe | UnternehmerBrief Bauwirtschaft | 9/2023 | 1-44 | Gesamtausgabe |
| Inhalt: Bautechnik 8/2023 | Bautechnik | 8/2023 | Inhalt | ||
| Titelbild: Bautechnik 8/2023 | Bautechnik | 8/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
| Ernst & Sohn (Hrsg.) | Sonderheft: CDE -- Common Data Environment 2023 | Bautechnik | 8/2023 | 1-52 | Sonderheft |
| Forman, Patrick | Nachhaltig miteinander | Bautechnik | 8/2023 | 443 | Editorials |
| Arnold, Matthias; Maderebner, Roland; Dietsch, Philipp; Winter, Stefan | Diagonallagenholz (DLH) - Ressourceneffizienz durch diagonale Orientierung einzelner Lagen: Bestimmung der Steifigkeitsparameter und Verformungsanalysen | Bautechnik | 8/2023 | 444-462 | Aufsätze |
KurzfassungDieser Aufsatz befasst sich mit der Entwicklung von diagonal verklebtem Brettsperrholz (Diagonallagenholz - DLH), einem Laminat aus Massivholzlamellen, welche zur Anpassung der Steifigkeitseigenschaften in einem bestimmten Winkel zueinander angeordnet werden. DLH stellt somit eine anwendungsoptimierte Weiterentwicklung von Brettsperrholz (BSP) dar und erreicht bei gleichem Materialeinsatz verbesserte mechanische Eigenschaften. Der Beitrag beschäftigt sich mit der analytischen Herleitung der Steifigkeitsmatrix, der experimentellen Charakterisierung und numerischen Verformungsanalysen. Die Untersuchungen wurden mit spezifischen DLH-Serien durchgeführt, welche durch die Ausrichtung von Lagen unter Winkeln von ±45° bzw. ±30° (±60°) gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Torsionssteifigkeit im Vergleich zu BSP deutlich erhöht ist. Diese Eigenschaft ist vielversprechend für die Anwendung von DLH in Platten unter zweiachsiger Biegebeanspruchung, wie z. B. punktgestützten Flachdecken. Hierbei verspricht die diagonale Ausrichtung einzelner Lagen zudem Homogenisierungseffekte bei der Verteilung von Biege- und Schubspannungen. Gleichzeitig führt die diagonale Orientierung einzelner Lagen zu einer Erhöhung der Scheibenschubsteifigkeit, welche hinsichtlich aussteifender Wand- und Deckenelemente von großem Interesse ist. Die Forschung an DLH hebt die Relevanz und Eignung diagonal ausgerichteter Lagen in Massivholzelementen für einen effizienteren und damit nachhaltigen Umgang mit der Ressource Holz hervor. x | |||||
| Diers, Johannes; Wenner, Marc; Slovák, Bohdana; Marx, Steffen | Zulässige Schienendruckkräfte für den Nachweis der Gleis-Tragwerks-Interaktion bei Fester Fahrbahn | Bautechnik | 8/2023 | 463-475 | Aufsätze |
KurzfassungBeim modernen Oberbau mit lückenlos verschweißter Schiene entstehen auf Brücken durch die Interaktion mit dem Bauwerk höhere axiale Beanspruchungen der Schiene als auf dem Damm. Beim Schotteroberbau gilt es die Druckkräfte in der Schiene zu begrenzen, um Gleisverwerfungen zu vermeiden. Dazu wurden in den 1980er-Jahren umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, woraus ein Grenzwert für die zulässigen zusätzlichen Druckspannungen von 72 MPa definiert wurde. Bei der Festen Fahrbahn liegen jedoch keine Erfahrungen zum Verhalten unter großen Druckkräften vor und der erhöhte Grenzwert von 92 MPa beruht auf keiner wissenschaftlich nachvollziehbaren Basis. Für den Fall der EÜ Itztal auf der Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt konnte der Nachweis der zusätzlichen Druckspannungen mit dem Grenzwert von 92 MPa nicht erbracht werden. Um fallspezifisch einen neuen Grenzwert festlegen zu können, wurden Untersuchungen vorgenommen, die in diesem Aufsatz vorgestellt werden. Das Verhalten des Systems unter großen Druckkräften wurde rechnerisch und experimentell untersucht. Für den Nachweis einer ausreichenden Sicherheit des Systems bei großen Schienendruckkräften wurden Grenzzustände festgelegt und für abgesicherte Einwirkungskombinationen nachgewiesen. Das Fallbeispiel zeigt die Reserven des Systems auf und legt eine mögliche Methode für eine grundsätzliche Überarbeitung des Grenzwerts der Schienendruckspannungen beim System Feste Fahrbahn vor. x | |||||
| Chen, Li; Casas, Gonzalo; Kasirer, Chen; Van Mele, Tom | COMPAS: Softwarelösung für komplexe Bauprojekte | Bautechnik | 8/2023 | 476-482 | Berichte |
KurzfassungIn einem Bauprojekt arbeiten verschiedene Disziplinen wie Architektur, Ingenieurwesen, Fachplanung und ausführende Bauunternehmen zusammen. Für den Entwurf, die statische Berechnung und die Ausführungsplanung werden unterschiedliche Softwarelösungen eingesetzt. Anpassungen im Entwurf und der Planung müssen zeitaufwendig in jeder einzelnen Softwarelösung manuell eingearbeitet werden. Bei komplexen Geometrien und innovativen Bauweisen sind zusätzliche Analysen und Anpassungen erforderlich, was mit heutigen Softwarelösungen kaum realisierbar ist. Für einen effizienten Datentransfer zwischen verschiedenen Softwareumgebungen wurde COMPAS entwickelt, sodass Innovationen im Bauwesen gefördert werden. COMPAS ist eine Open-Source-Umgebung, welche unabhängig von kommerziellen Softwarelösungen verwendet werden kann. Es verfügt über eine Geometriedatenbank, flexible Datenstrukturen für unterschiedliche Disziplinen und Algorithmen für Berechnungen wie z. B. Tragwerksanalysen. Es gibt zahlreiche COMPAS-Erweiterungen für spezifische Anwendungen wie Montageplanung, Holzbau, Roboterfertigung und additive Fertigung. Anfang 2023 wurde der Verein COMPAS gegründet, um die Weiterentwicklung und Ausbildung voranzutreiben. x | |||||
| Keßler, Sylvia; Beck, Matthias; Harnisch, Jörg; Angst, Ueli M. | Memorandum: Korrosionsschutz im Konstruktiven Ingenieurbau | Bautechnik | 8/2023 | 483-493 | Berichte |
KurzfassungEiner der maßgebenden Werkstoffe im Konstruktiven Ingenieurbau ist Stahl in Form von Baustahl, Betonstahl, Befestigungstechnik etc. Stahl bietet eine hohe Festigkeit in Kombination mit beliebiger Formbarkeit, guter Verarbeitbarkeit und Schweißbarkeit. Um das Potenzial von Stahl auszuschöpfen, ist das Wissen über dessen maßgebenden Schädigungsmechanismus - die Korrosion - essenziell, um Korrosionsprozesse durch konsequente Planung verhindern oder bestehende Korrosionsschäden bewerten und instand setzen zu können. Das Ziel dieses Hochschulmemorandums ist es, die Grundlagen der Kompetenzentwicklungen im Bereich des Korrosionsschutzes des Konstruktiven Ingenieurbaus zu legen, zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Aufgrund der zunehmend dynamischen Entwicklungen im Bauingenieurwesen (z. B. durch Digitalisierung, Nachhaltigkeitsvorgaben, neue Fertigungsmethoden, längere Lebensdauern von Bauwerken) ist die Bereitschaft einer stetigen Reflexion und Weiterentwicklung unumgänglich, um langfristig eine hohe Qualität im Korrosionsschutz konstruktiver Ingenieurbauwerke sicherstellen zu können. Das hier vorliegende Memorandum ist in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis “Korrosionsschutz im konstruktiven Ingenieurbau” der Gesellschaft für Korrosionsschutz e. V. (GfKORR) und dem bauforumstahl e. V. entstanden. x | |||||
| Bredow, Danica; Brühwiler, Eugen; Thorstensen, Rein Terje; Schacht, Gregor | Anwendung von UHFB im Brückenbau - Beispiele und Herausforderungen für die Praxis | Bautechnik | 8/2023 | 494-500 | Berichte |
KurzfassungUHFB ist ein zementgebundener ultra-hochleistungsfähiger Faserverbund-Baustoff, der sich durch seine Materialeigenschaften für die Instandsetzung und Verstärkung von Betonbauwerken wie Brücken eignet. Eine auf das Stahlbetonbauteil aufgebrachte UHFB-Schicht erhöht den Tragwiderstand signifikant und übernimmt auch die Abdichtungsfunktion. Während UHFB in der Schweiz, speziell für Brücken, schon regelmäßig angewendet wird, ist die Technologie vielerorts in Europa und weltweit noch relativ unbekannt und wird noch selten eingesetzt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Das Fehlen von normativen Grundlagen in vielen Ländern ist nur eine der Herausforderungen. Um eine Voraussetzung für eine Verbreitung von UHFB in Deutschland und anderen Ländern zu schaffen, sollte länderübergreifend zusammengearbeitet werden. Die Erfahrung der Schweiz mit mehr als 350 realisierten UHFB-Projekten könnte von anderen Ländern genutzt werden, bspw. um eine europäische Norm zu entwickeln. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über mögliche Anwendungen von UHFB im Brückenbau, stellt den aktuellen Stand der Regelungen zu UHFB in verschiedenen europäischen Ländern vor und analysiert, welche Randbedingungen und Voraussetzungen erforderlich sind, damit sich eine neue Bauweise erfolgreich durchsetzen kann. x | |||||
| Knight, Martin | The social power of infrastructure design - 100 years of "Bautechnik" - building for future generations | Bautechnik | 8/2023 | 501-508 | Essays |
| Bautechnik aktuell 8/2023 | Bautechnik | 8/2023 | 509-511 | Bautechnik aktuell | |
KurzfassungNachrichten: x | |||||
| Kongresse - Symposien - Seminare - Messen | Bautechnik | 8/2023 | 511 | Veranstaltungskalender | |
| Inhalt: Beton- und Stahlbetonbau 8/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | Inhalt | ||
| Titelbild: Beton- und Stahlbetonbau 8/2023 | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | Titelbild | ||
Kurzfassung
x | |||||
| Strauss, Alfred | Lebenszyklusorientierte Planungs- und Instandhaltungsphilosophie | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 541 | Editorials |
| Heinlein, Ulli | Mechanisch-adhäsive Frischbetonverbundsysteme: Untersuchungen zur Verbundentwicklung und Haftzugfestigkeit | Beton- und Stahlbetonbau | 8/2023 | 542-555 | Aufsätze |
KurzfassungFrischbetonverbundsysteme werden als zusätzlich abdichtende Maßnahme auf wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen eingesetzt und bereits vor dem Betoneinbau verlegt. Sie erzielen einen Verbund mit dem Frischbeton und nutzen dafür u. a. Vliese, die während des Betoneinbaus mit Zementleim gefüllt werden müssen. Allerdings ist bisher nicht bekannt, wie sich Zementleim aus dem Frischbeton abtrennt, welche Eigenschaften er im Vlies hat oder welche Vlieseigenschaften für FBVS vorteilhaft sind. Der Beitrag beschäftigt sich daher mit dem Vliesverbund und betrachtet zuerst das Deformationsverhalten der Vliese im Betonierprozess. Während des Betoneinbaus werden Vliese zuerst komprimiert und entspannen sich mit fortlaufender Zementleimfüllung. Sobald der Frischbeton eingebracht ist, beginnen außerdem Filterprozesse, die Überschusswasser und eine begrenzte Menge feiner Feststoffe in das Vlies abtrennen. Dabei bildet sich ein Filterkuchen auf dem Vlies und ein wasserreicher Zementleim im Vlies. Erst mit einsetzender Vibrationsverdichtung wird der Filterkuchen gelockert, weiterer Feststoff in das Vlies eingetragen, das Wasser-Feststoff-Verhältnis im Vlies gesenkt und ein Hinterlaufschutz erreicht. Der Haftverbund entwickelt sich anschließend proportional zur Spaltzugfestigkeit des Betons und wird maßgeblich durch die Zementsteinfestigkeit beeinflusst. Porenarme und leichte Vliese sind dabei vorteilhaft, da sie weniger Überschusswasser aus dem Frischbeton abtrennen. x | |||||