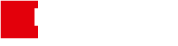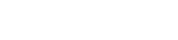Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Richtfest für Sonnenkraftwerk - Neues Finanzierungsmodell für Solaranlagen | Bauphysik | 2/1995 | 59 | Aktuelles | |
| Ehrendoktorwürde für Peter Schuhmacher | Bauphysik | 2/1995 | 61 | Persönliches | |
| Prof. Peter Lutz gestorben | Bauphysik | 2/1995 | 61-62 | Persönliches | |
| Häupl, P.; Roloff, J. | 9. Bauklimatisches Symposium des Institutes für Bauklimatik der Fakultät Architektur an der Technischen Universität Dresden, 14.-16. September 1994 | Bauphysik | 2/1995 | 62-63 | Berichte |
| Wechsel in der Obmannschaft von CEN/TC 88 "Wärmedämmstoffe" | Bauphysik | 2/1995 | 62 | Persönliches | |
| Künzel, H. | Zum heutigen Stand der Kenntnis über das UK-Dach | Bauphysik | 1/1995 | 1-7 | Fachthemen |
KurzfassungUmkehrdächer (UK-Dächer) kommen in Deutschland seit etwa drei Jahrzehnten zur Anwendung und haben sich bewährt. Das Konstruktionsprinzip des UK-Daches ist mit Dämmstoffen möglich, die kein Wasser in flüssiger Form aufnehmen und einen großen Wasserdampf-Diffusionswiderstand aufweisen. Dies ist bei extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten der Fall, wobei sich besonders der erhöhte Diffusionswiderstand an den Plattenoberflächen (Schäumhaut) günstig auswirkt. Um die Tauwasserbildung in der Dämmschicht gering zu halten und die Feuchte nach außen abführen zu können, muß die Luft oberhalb der Dämmplatten aufnahmefähig für Wasserdampf sein. Die sich im Dämmstoff einstellenden Feuchteverhältnisse sind kalkulierbar und können bei der Wärmeschutzbewertung berücksichtigt werden. Die Dachhaut ist durch die Dämmschicht vor größeren Temperaturschwankungen geschützt. Gegenüber diesen Vorteilen sollte der Nachteil des k-Zuschlags wegen des zeitweiligen Unterströmens der Dämmplatten durch Regenwasser nicht überbewertet werden. x | |||||
| Sonnenstrom aus Spanien - RWE Energie weiht in Toledo Europas größtes Sonnenkraftwerk ein | Bauphysik | 1/1995 | 7 | Aktuelles | |
| Wärmepumpen: Rückgang um 1.6 % | Bauphysik | 1/1995 | 7 | Aktuelles | |
| Künzel, H. | Die Bedeutung der Schäumhaut und Dämmschichtdicke für das Feuchteverhalten von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten | Bauphysik | 1/1995 | 8-10 | Fachthemen |
KurzfassungDie Dämmschicht in Umkehrdächern, insbesondere wenn diese begrünt sind oder einen relativ dichten Oberflächenbelag besitzen, ist einer besonders hohen Feuchtebelastung ausgesetzt. Als einziger Dämmstoff erfüllt bisher extrudierter Polystyrol-Hartschaum die Zulassungsvoraussetzungen für diese Art der Flachdachkonstruktion. Aufgrund von theoretischen Überlegungen und experimentellen Untersuchungen hat sich gezeigt, daß der Schäumhaut und der Dicke der Dämmplatten eine besondere Bedeutung zukommt, wenn es um die Höhe der Wasseraufnahme des Dämmstoffs im Temperaturgefälle geht. Die Schäumhaut bewirkt eine Reduktion der Feuchteaufnahme aber auch der Feuchteabgabe von XPS-Dämmplatten. Eine größere Plattendichte hat eine Verringerung der Feuchteaufnahme zur Folge. x | |||||
| Antragsverfahren für Solaranlagen und Niedrigenergiehäuser - Förderung von Brennwertanlagen eingestellt | Bauphysik | 1/1995 | 10 | Aktuelles | |
| Krollmann, N. | Langzeitverhalten von extrudiertem Polystyrol-Hartschaum bei konstanter und zyklisch wechselnder Druckbeanspruchung | Bauphysik | 1/1995 | 11-16 | Fachthemen |
KurzfassungIn zunehmendem Maß werden Wärmedämmstoffe in Baukonstruktionen eingesetzt, in denen sie langzeitigen Druckbelastungen ausgesetzt sind. Beispiele hierfür sind Perimeterdämmungen, Parkdecks, Flugfeldanlagen, Straßen- und Gleisbau. Zur Abschätzung der dabei auftretenden Langzeitverformung, dem Kriechen, werden üblicherweise Zeitstanddruckversuche durchgeführt. Im Rahmen der Europäischen Normung wurde von CEN TC 88, WG 1, ein Normentwurf zur Bestimmung des Langzeitverhaltens erstellt, in dem sowohl das Meßprinzip als auch ein Verfahren zur mathematischen Beschreibung und der Extrapolation des Langzeitverhaltens dargelegt ist. Am Beispiel von extrudierten Polystyrol-Hartschäumen werden Ergebnisse aus Zeitstanddruckversuchen dargestellt sowie die Anpassungs- bzw. Extrapolationsmöglichkeiten diskutiert. Desweiteren wird auf Untersuchungen eingegangen, die die zyklisch wechselnde Beanspruchung in Parkdecks simulieren. x | |||||
| Lucas, H. G.; Ludwig, U.; Oel, H. J. | Die Beständigkeit historischer Gipsmörtel innen und außen - Diagnose bauphysikalischer Vorgänge, Erhaltungs- und Sanierungsvorgänge | Bauphysik | 1/1995 | 17-26 | Fachthemen |
KurzfassungEs werden die Bedingungen erarbeitet, unter denen die historischen Gipsmörtel ihre ursprüngliche Qualität einbüßen. Erst wechselnde Durchfeuchtungs- und Trocknungsbedingungen oder ständige Durchfeuchtung auf der einen und gleichzeitige Trocknung auf der anderen Seite des Bauteils führten bei langfristiger Beanspruchung zu einem irreversiblen Festigkeitsverlust. Die Ursache ist eine Rekristallisation und Umlagerung der Gipskristalle, die sich in Gipsausblühungen auf der Oberfläche und - je nach den Bedingungen - in einer Lockerung des Gefüges äußern. Diese Erkenntnisse wurden bei der gefügekundlichen Untersuchung von historischen Gipsmörteln vor allem im Raum Bad Windsheim in Nordbayern gewonnen. Es werden der gute Erhaltungszustand und die einzelnen Schritte des Qualitätsabbaus diagnostiziert und es werden Erhaltungs- und Sanierungsempfehlungen vorgelegt. x | |||||
| Leuschner, U | Kontroverse Standpunkte beim "Fachkolloquium Elektrosmog": Gibt es ein Gesundheitsrisiko durch Felder | Bauphysik | 1/1995 | 27-28 | Berichte |
| 12. Europäische Konferenz über Photovoltaik, Amsterdam, 11.-15.04.1994 | Bauphysik | 1/1995 | 29-30 | Berichte | |
| Persönliches Professor Günter Zimmermann 70 Jahre | Bauphysik | 1/1995 | 29 | Persönliches | |
| HEA-Herbsttagung '94 in Bielefeld | Bauphysik | 1/1995 | 30-31 | Berichte | |
| Heusler, W.; Scholz, Ch. | Die Lichtausbeute der Solarstrahlung - Ergebnisse einer experimentellen Untersuchung | Bauphysik | 6/1994 | 165-169 | Fachthemen |
KurzfassungTageslichttechnische Betrachtungen müssen ausgehend von dem zur Verfügung stehenden Tageslichtangebot, der Beleuchtungsstärke im Freien, durchgeführt werden. Aufzeichnungen der Beleuchtungsstärke liegen nur in den seltensten Fällen vor. Strahlungsdaten dagegen werden in aller Regel schon seit längerer Zeit von sehr vielen Beobachtungsstationen aufgezeichnet. Die bekannten Verfahren der Umrechnung von Bestrahlungsstärke in Beleuchtungsstärke wurden gegenübergestellt und durch Auswertung von Meßdaten über einen Zeitraum von einem Jahr überprüft und ergänzt. Hiermit steht ein weiteres Werkzeug zur besseren Beurteilung lichttechnischer Maßnahmen, die die Nutzung von Tageslicht einbeziehen, zur Verfügung. x | |||||
| Vahldiek, J.; Oswald, D. | Transparente Wärmedämmsysteme in einem sanierten Altbau - Pilotvorhaben Sonnenäckerweg, Freiburg | Bauphysik | 6/1994 | 170-180 | Fachthemen |
KurzfassungEin nach Südosten orientiertes zweistöckiges Mehrfamilienhaus wurde wärmetechnisch saniert. Neben Verbesserungen des Wärmeschutzes im Wand-, Decken- und Fensterbereich wurde die Südost- und Südwest Fassade mit Transparenten Wärmedämmsystemen (TWD-System) ausgerüstet. Gebäude und TWD-System waren experimentell auf ihr thermisches und energetisches Verhalten unter verschiedenen klimatischen Bedingungen zu untersuchen. Der Netto-Heizenergieverbrauch betrug in der Heizperiode 1990/91 40 kWh/m² . Die solaren Gewinne des TWD-Systems trugen zur Energiebilanz mit 22 % bei und bewirkten eine Heizenergieeinsparung von 12,7 kWh/m² Wohnfläche gegenüber einer Ausführung mit opaker Dämmung. Die Sonnenschutzmaßnahmen waren effektiv: es trat keine Überwärmung unter sommerlichen Bedingungen auf. TWD-Systeme lassen sich gut im Altbaubestand einsetzen. x | |||||
| Rogaß, H.; Donath, A.; Gutschker, O. | Instationäres Auswerteverfahren für Wärmedämmessungen | Bauphysik | 6/1994 | 181-185 | Fachthemen |
KurzfassungDie thermischen Kenngrößen von Baustoffen können im Labor präzise bestimmt werden. Zur Bewertung des energetischen Verhaltens von Gebäudebauteilen müssen jedoch die durch die Nutzungsumstände bedingten Veränderungen dieser Kenngrößen berücksichtigt werden. Diese tatsächlichen Werte erhält man nur durch In-Situ-Messungen. Probleme bei der Auswertung derartiger Messungen durch die bekannte Mittelungs-Methode werden anhand von Modellrechnungen aufgezeigt. Eine Erhöhung der Zuverlässigkeit der Messung, verbunden mit einer Reduzierung der notwendigen Meßdauer, ist durch die Anwendung eines dynamischen Auswerteverfahrens möglich, bei dem die instationären Temperaturverhältnisse im untersuchten Bauteil Berücksichtigung finden. Ein solches Verfahren sowie Betrachtungen zur erreichbaren Genauigkeit werden vorgestellt. x | |||||
| Öffentliche Versorgung 1992: 94 % des Stroms aus Großkraftwerken | Bauphysik | 6/1994 | 185 | Aktuelles | |
| INSPEC und FIZ unterzeichnen Kooperationsvertrag | Bauphysik | 6/1994 | 185 | Aktuelles | |
| Gemeinsames Forschungsprojekt mit Polen | Bauphysik | 6/1994 | 185 | Aktuelles | |
| Marquardt, H. | Tauwasserausfall in Wintergärten vor Geschoßwohnungen | Bauphysik | 6/1994 | 186-195 | Fachthemen |
KurzfassungWintergärten dürfen nicht nur als energiesparende und wohnwertverbessernde Maßnahmen betrachtet werden. Voraussetzung dafür ist eine bauphysikalisch richtige Ausführung. Insbesondere bei Geschoßwohnungen führen ungünstig geplante Wintergärten zu Korrosions- und Durchfeuchtungsschäden infolge Tauwasserausfalls sowie als Folge zu rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen durch veränderte Nutzer. Anhand von zwei durchgerechneten Beispielen wird gezeigt, daßdurch geänderte Wohnungsgrundrisse einerseits und verbesserte Konstruktionen andererseits Tauwasserschäden in Wintergärten vermieden werden können. x | |||||
| Becker, W.; Hertel, H.; Klingendörfer, H. G.; Wesche, J. | Baulicher Brandschutz (CEN-Arbeit, Stand 1994-10-15) | Bauphysik | 6/1994 | 195-197 | Berichte |
| Thermo-hygrische Formänderungen und Eigenspannungen von natürlichen Mauersteinen (U. Möller) | Bauphysik | 6/1994 | 198 | Dissertationen | |