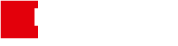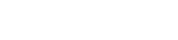Artikeldatenbank
| Autor(en) | Titel | Zeitschrift | Ausgabe | Seite | Rubrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabener, H. G. | Über die Abweichungen vom Darcyschen Gesetz bei der Durchströmung bindiger Böden. | Bautechnik | 10/1984 | 351-357 | |
KurzfassungEs wird über ein Versuchsprogramm und seine Ergebnisse berichtet, bei dem zwölf verschiedene feinkörnige Böden vom Grobschluff bis zum Ton hinsichtlich ihrer Durchlässigkeit und Filtergesetze bei hydraulischen Gefällen zwischen rund 0.2 und 30 untersucht wurden. Die durchgeführten Versuche und Bewertungen lassen genauere Aussagen über die Filtergesetze bindiger Böden im linearen als auch im sogenannten prälinearen Strömungsbereich zu. x | |||||
| Curbach, Manfred | Über die aktuellen Zwänge hinausdenken | Beton- und Stahlbetonbau | 2/2021 | 75 | Editorials |
| Ramm, Wieland | Über die Anfänge des Eisenbetonbaus in Deutschland und die Pioniere der ersten Jahre | Beton- und Stahlbetonbau | 5/2012 | 335-356 | Bericht |
| Lang, Robert; Ladinek, Markus; Lener, Gerhard | Über die Anpassung eines fortschrittlichen Stützwirkungsansatzes für das Kerbspannungskonzept - Ein impliziter Gradientenansatz als Ersatz für Ausrundungen bei der Ermittlung der Schwingfestigkeit von geschweißten Verbindungen | Stahlbau | 6/2017 | 470-482 | Fachthemen |
KurzfassungDer Nachweis der Betriebsfestigkeit für geschweißte Verbindungen nach dem Kerbspannungskonzept erfordert vor der Berechnung der Spannungen eine fiktive Ausrundung der Geometrie im Bereich des Nahtüberganges und der Wurzel. Diese Ausrundung verhindert einerseits die sonst zwangsläufig auftretende Spannungssingularität und modifiziert gleichzeitig die Spannung um die Kerbempfindlichkeit. In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, das auf die Ausrundung verzichtet und dennoch alle erforderlichen Aspekte der Beurteilung der Betriebsfestigkeit nach dem Kerbspannungskonzept beinhaltet. x | |||||
| Ludwig, D. | Über die Anwendbarkeit von Massiv-Sandwichflächentragwerken im Geschoßbau | Bautechnik | 5/1999 | 423-426 | Berichte |
| Bercea, G. | Über die Anwendung von Federn in statischen Berechnungen. | Bautechnik | 8/1983 | 274-280 | |
KurzfassungKritische Auseinandersetzung mit der Anwendung von Federn in statischen Berechnungen und Einführung einer neuartigen, dreiwertigen Feder für rotationssymmetrische Schalen. x | |||||
| Dudek, D.; Gronowicz, A.; Twarog, W. | Über die Aufhängung von Abwrfauslegern von Bandabsetzern und Kranen. | Stahlbau | 1/1992 | 17-20 | Fachthemen |
KurzfassungEs wurde die Analyse von wantenartigen Auslegeraufhängungen durchgeführt. Um die Vorteile der Anwendung von wantenartigen Aufhängungen deutlicher hervorzuheben, wurden Vergleichsberechnungen angestellt. Im Hinblick auf die Tatsache, daß diese Analyse nicht in die Geometrie des Auslegers eingreift, hat diese Aufhängung auch keinen Einfluß auf die innere Konstruktion des Auslegers. Die nach anderen Kriterien optimalen Lösungen sind auch bei den wantenartigen Lösungen optimal. x | |||||
| Homberg, H. | Über die Auflösung von linearen Gleichungssystemen mit Hilfe einer Eigenwertbetrachtung. | Bautechnik | 2/1967 | 37-41 | |
KurzfassungEs wird gezeigt, daß jedes statisch unbestimmte System planmässig mit Hilfe einer Eigenwertbetrachtung auf Gleichungen mit nur je einer Unbekannten zu überführen ist. x | |||||
| Mann, W. | Über die Ausbildung von Balkenauflagern und Auflagerkonsolen aus Stahlbeton. | Beton- und Stahlbetonbau | 1/1975 | 1-4 | |
KurzfassungEs werden Empfehlungen für die Berechnung und Konstruktion von Konsolen und ausgeklinkten Balkenauflagern im Fertigteilbau gegeben. Die auftretenden Schäden durch konstruktive Fehler und Ausführungsmängel bedrohen immmer die Standsicherheit und sind schwer zu beheben. x | |||||
| Martini, A.; Mennenöh, S. | Über die Ausbildung von Makroelementen an Spundbohlen in Meerwasser. | Stahlbau | 9/1981 | 280-283 | Berichte |
| Heckeroth, H. | Über die aussteifende Wirkung einlagiger genagelter Brettscheiben. | Bautechnik | 12/1969 | 401-405 | |
KurzfassungEs werden Wirkungsweise und Tragfähigkeit von aussteifenden Scheiben, die aus einlagigen vernagelten Brettern gebildet werden, durch eine Berechnung und experimentell untersucht. x | |||||
| Rosemeier, G.-E. | Über die Bedeutung des erweiterten Hamiltonschen Prinzips bei instationären nichtkonservativemn Problemen. | Bautechnik | 6/1976 | 202-203 | |
KurzfassungÜber die Anwendung der Thermodynamik auf Probleme der Mechanik wie Kriechen und Schwinden von Beton und das Setzungsverhalten von Bodenproben. x | |||||
| Anastasescu, D.; Munteanu, I. | Über die Berechnung der orthogonalen räumlichen Rahmen. | Bautechnik | 7/1968 | 240-245 | |
KurzfassungDie Berechnung von räumlichen Rahmensystemen mit Hilfe des Verschiebungsgrössenverfahrens und die Aufbereitung der Ausgangswerte für eine Berechnung mit elektronischen Rechnern. x | |||||
| Kamerling, J. W.; Kuyt, B. | Über die Berechnung der Schubtragfähigkeit von Stahlbeton- und Spannbetonbalken. | Beton- und Stahlbetonbau | 8/1976 | 193-201 | |
KurzfassungEs wird ein Rechenverfahren für die Querkraftbemessung vorgestellt, das sowohl für Stahlbeton- als auch für Spannbetonbalken anwendbar ist. Gleichzeitig erfasst es den gesamten Bereich von schlanken bis zu gedrungenen Balken. Die theoretischen Werte der damit bestimmbaren Querkrafttragfähigkeit wird mit 390 internationalen Versuchsergebnissen verglichen. x | |||||
| Göhler, B.; Seifried, G. | Über die Dauerhaftigkeit schlaff bewehrter Fahrbahnplatten von Strassenbrücken. | Beton- und Stahlbetonbau | 9/1986 | 225-229 | |
KurzfassungDiskussion über das Ermüdungsverhalten und die erforderliche Rissebeschränkung von schlaff bewehrten Betonfahrbahnplatten. Notwendige Verbesserungen ergeben sich bei der Rissebeschränkung und der Verformungsberechnung. Die Ermüdungssicherheit reicht aus. An einem Beispiel werden die Anwendungsgrenzen gezeigt, die für eine Kragplatte bei etwa 4 m Spannweite liegen. Für Stahlbetonplatten, deren Gebrauchsverhalten und Dauerhaftigkeit vorgespannten Platten entsprechen, werden Konstruktions- und Bemessungsregeln genannt x | |||||
| Petersen, G.; Schmidt, H. | Über die Druckausbreitung von Einzellasten in Teilschichten (Grossversuche und Berechnungsvorschlag). | Bautechnik | 6/1979 | 194-198 | |
KurzfassungIm Rahmen des Schnellbahnbaues in Hamburg wurden Grossversuche zur Ermittlung der Druckausbreitung von Einzellasten über Tunneldecken bei Überschüttungshöhen zwischen 0.50 m und 2.50 m durchgeführt. Auf der Grundlage der ermittelten Messwerte und der erweiterten Theorie von Fröhlich wird ein Berechnungsverfahren mit eingeschränkter Druckausbreitung vorgeschlagen. x | |||||
| Fiedler, E. | Über die Druckverlustberechnung, insbesondere aus Simulationsergebnissen | Bauphysik | 6/2009 | 374-379 | Fachthemen |
KurzfassungDer Strömungswiderstand technischer Komponenten wird durch den Druckverlustbeiwert ζ beschrieben. Für die experimentelle Bestimmung existieren normierte Verfahren, bei der Bestimmung aus Simulationsdaten steckt die Tücke allerdings im Detail. Der vorliegende Artikel erläutert die Grundlagen der Druckverlustberechnung. Es wird auf die besondere Problematik der Berechnung von Druckverlusten aus Simulationsergebnissen eingegangen. x | |||||
| Rosemeier, G.-E.; Wollrath, J. | Über die Einbindung der EDV in die praktische Normung. | Bautechnik | 1/1985 | 5-10 | |
KurzfassungDie Weiterentwicklung der Normen des konstruktiven Ingenieurbaus wirft die Frage auf, inwieweit höhere theoretische Erkenntnisse in praktische Normen eingearbeitet werden können. Es wird vorgeschlagen, zukünftige Normen auf einfache Bemessungsfälle mit idealisierten Annahmen zu beschränken und schwierige Konstruktionen unter Vorgabe bestimmter physikalisch-technischer Grundwerte der EDV-Berechnung selbstständig zu überlassen. Ein besonders systematisierbares Rechenverfahren wird am Beispiel stbilitätsgefährdeter Stahlbetonstützen vorgestellt. x | |||||
| Rosemeier, G.-E. | Über die elektromagnetischen Grundgesetze. | Bautechnik | 2/1984 | 37-40 | |
| Esslinger, M. | Über die Endringe an axialgedrückten Kreiszylindern, die am unteren Rand eingespannt sind. | Stahlbau | 12/1995 | 353-360 | Fachthemen |
KurzfassungEs werden Näherungsformeln aufgestellt für die Dimensionierng der oberen Endringe von axialgedrückten Zylindern, die am unteren Rand eingespannt sind. Es wird angegeben, bis zu welchen Grenzen diese Formen gültig sind. x | |||||
| Esslinger, M. | Über die Endringe von axialgedrückten Kreiszylindern. | Stahlbau | 11/1994 | 361 | Berichte |
| Esslinger, M. | Über die Endringe von axialgedrückten Kreiszylindern. | Stahlbau | 7/1994 | 200-205 | Fachthemen |
KurzfassungAlle Schalenbeulvorschriften für Zylinder beginnen mit der Feststellung, daß sie nur gelten, wenn an beiden Rändern die Verschiebungen u = w = 0 sind. Die Frage, wie man diese Bedingung erfüllen kann, wird stiefmütterlich behandelt. Der Bericht hilft diesem Manko teilweise ab; er beschreibt ein Näherungsverfahren für die Dimensionierung der Endringe von axialgedrückten Zylindern. x | |||||
| Rosemeier, G.-E. | Über die Energieumwandlung in der Mechanik. | Bautechnik | 5/1981 | 145-148 | |
KurzfassungAusgehend von einfachen Anwendungsbeispielen in der Mechanik wird gezeigt, daß die konsequente Anwendung eines allgemein gültigen Energieumwandlungsgesetzes zu einer geschlossenen Systematik führt, wie sie bisher nicht in der Physik erkannt worden ist. Als dieses Energieumwandlungsgesetz ist in der Mechanik das erweiterte Hamiltonsche Prinzip anzusehen. x | |||||
| Ramm, W. | Über die Geschichte des Eisenbaus und das Entstehen des Konstruktiven Ingenieurbaus | Stahlbau | 9/2001 | 628-641 | Fachthemen |
KurzfassungFußend auf der wissenschaftlichen Entwicklung der Baustatik und der Technologie der Eisengewinnung wird die Geschichte des Eisenbaus im Abriß dargestellt. Triebfeder war der Bau großer Eisenbrücken, die durch den Ausbau der Straßen- und später der Eisenbahnnetze erforderlich wurden. Die Entwicklung des Eisenbaus ist nahezu identisch mit der Frühgeschichte des Konstruktiven Ingenieurbaus. Die Disziplin des konstruktiven Bauingenieurs erweist sich als eigenständige Neuentwicklung, nicht als Ergebnis einer Aufspaltung des traditionellen Baumeisterberufs in Architekt und Bauingenieur. x | |||||
| Herzog, M. | Über die Gleichrangigkeit von Lasten, Zwängen, und guter Konstruktion beim Entwurf von Massivbauten. | Bautechnik | 5/1987 | 172-175 | |
KurzfassungAnhand von Fallstudien wird gezeigt, daß Einflüsse von Zwängen und konstruktiven Mängeln die Massivbauten nachhaltiger gefährden können als eine Unterschätzung von Lasten x | |||||